GGG Magazin
ImFokus – SchuleImFokus:
Lernen in der digitalen Welt
GGGaktiv:
– Otto-Herz-Symposium
– Hauptausschuss und Mitgliederversammlung
– GGG-Positionspapier
EinblickPolitik:
John Hattie zum deutschen Schulsystem
Das ganze Heft: DIE SCHULE FÜR ALLE 2025/4
INHALT
Editorial / Impressum
IMPRESSUM WER FÜR UNS SCHREIBT
Editorial hier lesen
Editorial
Dieter Zielinski
Liebe Mitglieder der GGG,
liebe Leserinnen und Leser,
in der Ausgabe 2025/1 des Spiegels kritisierte John Hattie die frühe Trennung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland und folgerte, das deutsche Schulsystem sei das ungerechteste, das er kenne. Diese Äußerung erregte großes Aufsehen, denn Hatties Erkenntnisse wurden in bildungspolitischen Kreisen bislang oft darauf reduziert, dass es auf den Lehrer ankäme und nicht auf das Schulsystem. In einem in diesem Magazin nachzulesenden Schreibinterview befragten Ursula Reinartz und Peter Ehrich John Hattie nach den Eigenschaften eines gerechten und effektiven Schulsystems. Sie wollten auch von ihm wissen, wie das deutsche Schulsystem gerechter, integrativer und inklusiver gestaltet werden könne. Genau darauf zielt ein kürzlich von einer Mitgliederversammlung der GGG einstimmig verabschiedetes Positionspapier zur Weiterentwicklung der Schulen des gemeinsamen Lernens ab. Das vollständige Positionspapier finden Sie auf unserer Website. Eine kompakte Einführung erfolgt in diesem Magazin. Barbara Riekmann und Konstanze Schneider berichten zudem über die Mitgliederversammlung und eine Hauptausschusssitzung.
Ursula Reinartz und Peter Ehrich haben es sich nicht nehmen lassen, John Hattie auch zum Schwerpunktthema dieses Magazins zu befragen. In seinen Antworten beleuchtet er Potenziale und Risiken für das schulische Lernen insbesondere im Kontext Künstlicher Intelligenz. Hattie erwartet, dass KI, ähnlich wie andere Computertechnologien, nur langsam Einzug in Schulen halten und das Wesen des Unterrichts verändern wird. Dagegen sieht Jöran Muuß-Merholz in seinem Artikel „KI steht in der Schule für ‚Krise der Identität‘“ in der neuen Technologie die historische Chance, Schule grundlegend neu zu denken und zu gestalten. Olaf-Axel Burow skizziert in sieben Handlungsoptionen für mehr Bildungsgerechtigkeit seine Vision der Schule der Zukunft in Zeiten von KI. Florian Nuxoll erläutert, warum „Deskilling“ durch KI als Chance und „Skill-Skipping“ als zu bewältigende Gefahr zu betrachten sind.
Überblicksartikel zu den Handlungsempfehlungen der KMK zum Umgang mit künstlicher Intelligenz sowie zu den Empfehlungen des Deutschen Ethikrates zu Digitalisierung und KI in der Schule runden den theoretischen Rahmen unseres Schwerpunktthemas ab.
Auch in diesem Magazin kommt die Praxis nicht zu kurz: In der „Rubrik Schule im Fokus“ berichten fünf Beiträge über konkrete Erfahrungen. Konstanze Schneider befragte Schülerinnen und Schüler der Richtsbergschule in Marburg zu ihrer Haltung und ihren Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien und KI in der Schule. Barbara Riekmann führte ein Interview mit Micha Pallesche von der mehrfach ausgezeichneten Ernst-Reuter Gemeinschaftsschule in Karlsruhe; dabei wird sichtbar, wie digitale Kultur, neue Lernkulturen und Schulentwicklung eng miteinander verknüpft sind und welche Ergebnisse daraus hervorgehen. Die Sport- und Kreativitätsgesamtschule des Leonardo da Vinci Campus in Nauen begann 2016 ihren Weg in die Digitalität. Linda Ritzka beschreibt den Werdegang und die entwickelte Praxis. Wie und wozu er KI im Unterricht eingesetzt hat, erläutert uns Roy Hahn von der Grund- und Gemeinschaftsschule „Am Brook“ in Kiel. „KI an Bord, du am Steuer“ ist der Leitspruch einer Arbeitsgruppe der Georg-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen, die eine fünfteilige Fortbildungsreihe für die Lehrkräfte der Schule entwickelt hat, in der sich diese mit unterschiedlichen Aspekten von KI im Schulalltag vertraut machen konnten. Über das Projekt berichtet Susanne Lührs.
All dies und noch manches mehr finden Sie in diesem Magazin.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch im Namen der Redaktion eine bereichernde Lektüre.
GGGaktiv
Berichte aus der bildungspolitischen Verbandsarbeit
Die ganze Rubrik GGGaktiv mit allen Artikeln steht Ihnen zum Herunterladen zur Verfügung.
D. Zielinkski: Otto-Herz-Symposium 2025
Otto Herz Symposium 2025 – Ein HERZens-Symposium für Otto
Eine Veranstaltung im Zeichen des Friedens
hier lesen
Dieter Zielinski
Am 20. September 2025, dem Weltkindertag, fand im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben das Otto Herz Symposium 2025 statt – ein besonderer Tag der Erinnerung, des Austausches. Eingeladen waren alle Freunde und Weggefährten von Otto Herz, dessen Wirken und Menschlichkeit bis heute nachwirken. In der Einladung zum Symposium hieß es treffend:
„Otto ist von uns gegangen – doch seine Spuren bleiben. In den Herzen der Menschen, in seinen Taten, in seinen berührenden poetischen Texten. Ottos tiefe Menschlichkeit, seine Herzens-Haltungen und seine Weisheiten werden uns weiter stärken und beflügeln.“
Ein Schwerpunkt des Symposiums war die Vorstellung eines Buches über Otto Herz, das Tim Wiegelmann angeregt hat und das unter Mithilfe von Margret Rasfeld und Katarina Wyss-Schley herausgegeben wurde. Darin teilen Freunde und Weggefährten mit, was Otto für sie bedeutet hat und was sie mit ihm erlebt haben – ein bewegendes Zeugnis seines Einflusses. Einige Exemplare sind noch verfügbar. (1)
Zentrales Thema des Tages war Ottos Engagement für Frieden und Freiheit, die er als „zwei Seiten einer Medaille“ betrachtete. Beide seien „so wenig selbstverständlich“, betonte er stets. Als Friedensbotschafter setzte er sich für globales Denken und Handeln ein. Symbolisch dafür steht die Einrichtung eines Friedensraumes im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben – eine Nachgestaltung von Otto Herz‘ Seminarraum in Leipzig.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Aufstellung eines Friedenspfahles auf dem Gelände des Schulzentrums. Dieser trägt an den Seiten in verschiedenen Sprachen die Aufschrift „May Peace prevail on Earth“. Der erste Friedenspfahl wurde Mitte der 1970er Jahre aufgestellt. Mittlerweile gibt es mehr als 250.000 weltweit. Otto Herz hat an verschiedenen Orten der Erde Friedenspfähle gestiftet und mit errichtet.
Otto Herz war ein Mensch, der in Visionen dachte, aber stets die kleinen Schritte ging. Sein berühmtes Zitat „Viele wollen lieber das Schlechte, das Vertraute als das Neue, das Ungewohnte“ unterstreicht seine Haltung, Mut zur Veränderung zu fördern. Besonders engagierte er sich in der Beratung von Schulgründungen und bei der Schulentwicklung in Deutschland und im Ausland: So unterstützte und begleitete er die Initiative forikolo bei Schulgründungen in Sierra Leone. Zudem war er ein wichtiger Förderer von „Schüler helfen Leben“. Das Symposium ermöglichte den Teilnehmenden ihre diesbezüglichen Erfahrungen mit Otto Herz auszutauschen. Die Beiträge waren oft von tiefer Ergriffenheit getragen.
Ein letzter Höhepunkt des Symposiums war die Ankündigung eines Films über Otto Herz, der derzeit entsteht und schon in Ausschnitten vorgeführt wurde. Für die Fertigstellung werden noch finanzielle Mittel benötigt. Die GGG unterstützt die Finanzierung des Films über diesen besonderen Pädagogen und ehemaligen GGG-Vorsitzenden.
Das Symposium zeigte: Otto Herz‘ Wirken lebt weiter – in den Menschen, die er inspiriert hat, und in den Projekten, die er angestoßen hat.
–––
(1) Diese können (solange vorrätig) direkt bei Doreen Model () für 10,00 Euro (Selbstkostenpreis) zuzüglich Portokosten bestellt werden.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
B. Riekmann, K. Schneider: Hauptausschuss und Mitgliederversammlung
Hauptausschuss und Mitgliederversammlung treffen wichtige Entscheidungen
hier lesen
Barbara Riekmann, Konstanze Schneider
Bericht vom Hauptausschuss
Vom 26. bis zum 28.September 2025 trafen sich die Landesverbände der GGG zum Hauptausschuss (HA) in Bad Sassendorf. Der Hauptausschuss „rahmte“ die Mitgliederversammlung am 27. September. Acht Bundesländer waren mit ihren Vertretern und Vertreterinnen präsent, darunter nach längerer Abwesenheit auch der Landesverband Rheinland-Pfalz.
Traditionell wurden unter dem Tagesordnungspunkt „Berichte“ Informationen aus den Landesverbänden sowie den Gremien und Arbeitsgruppen ausgetauscht.
In den Länderberichten aus Niedersachsen und Hamburg wurden ein neuer Erlass, bzw. eine neue Ausbildungsordnung positiv hervorgehoben. Diese ermöglichen es, Bausteine einer neuen Lernkultur einfacher umzusetzen, so z. B. für Niedersachsen die Möglichkeit einer durchgängigen Binnendifferenzierung, fächerübergreifenden Unterrichts und einer Leistungsrückmeldung ohne Noten; für Hamburg wurden rechtlich neue Möglichkeiten für die Prüfungen zum Ersten und zum MittlerenSchulabschluss eröffnet. In einigen Landesverbänden herrschte jedoch Enttäuschung über die fehlende Unterstützung durch Schulaufsicht und ministerielle Ebene.
Die sechs Bundearbeitsgruppen (BAGen) der GGG stellten ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte dar. Die BAG Politik hatte intensiv am Positionspapier und der Vorbereitung der Mitgliederversammlung gearbeitet. Die BAG KMK berichtete von der Vorbereitung eines Treffens mit den Bildungsreferent:innen der Bundesländer für Februar 2026 in Schwerin. Die Arbeit der BAG Newsletter ist allen Abonnent:innen inzwischen präsent. Erörtert wurde, wie trotz aller datenschutzrechtlichen Auflagen mehr Abonnent:innen gewonnen werden könnten. Die BAG Website stellte den neuen Web-Auftritt vor; er soll Ende des Jahres 2025 unsere bisherige Homepage ersetzen. Die BAG „Die Schule für alle – Magazin“ stellte ihre Planung für 2026 vor, so u.a. ein Magazin zur Demokratiebildung und ein Magazin zur Nachbereitung des Bundeskongresses in Jena. Die BAG Öffentlichkeitsarbeit suchte und sucht dringend Interessent:innen für eine Mitarbeit.
In der Nachbereitung der Mitgliederversammlung (MV) wurde die gute Vorbereitung gelobt und die einmütige Abstimmung besonders positiv hervorgehoben. Auch der Ablauf der MV wurde als bereichernd und hinsichtlich der Atmosphäre als anregend empfunden. Einvernehmlich verständigte sich der HA darauf, dass jetzt eine Strategiediskussion in den Landesverbänden erfolgen sollte. In einem ersten Schritt sollen bis zur nächsten Sitzung des HA im Februar 2026 (eng angelehnt an das Positionspapier) die landesspezifischen Schwerpunkte herausgearbeitet und Handlungsmöglichkeiten beschrieben werden. Bekräftigt wurde der Wunsch nach einer Kurzfassung (möglichst eine Seite) des Positionspapiers.
Mit einem Ausblick auf den Bundeskongress 2026 „Demokratie (er)leben in Schulen des gemeinsamen Lernens“, der Verabschiedung einer Presseerklärung zum Positionspapier und dem Dank an alle, die an der Vorbereitung und Durchführung der Tagung beteiligt waren, endete der Hauptausschuss am Sonntag.
Bericht von der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung 2025 stand unter dem inhaltlichen und strategischen Ziel, das durch die BAG Politik in Anbindung an den HA erarbeitete „Positionspapier zur Weiterentwicklung der Schulen des gemeinsamen Lernens“ zu diskutieren und zu verabschieden. In Anwesenheit von 36 Mitgliedern wurde unter der Tagungsleitung von Gerhard Lein am Vormittag das Papier abschnittsweise diskutiert und am Nachmittag in seinen strategischen Aspekten erörtert und abgestimmt.
In der Einführung ging Dieter Zielinski auf die Genese des Papiers ein. Zwei Hauptausschüsse hatten sich im Vorwege damit befasst. Im Rahmen der Mitgliederanhörung von April bis Juni 2025 gingen 30 Änderungs- und Ergänzungsvorschläge ein, die von der BAG Politik in die jetzige Fassung eingearbeitet wurden.
Anschließend kommentierte der Experte für Schulstrukturfragen Dr. Benjamin Edelstein, der per Video zugeschaltet war, das Positionspapier. Er betonte, dass das Papier nicht nur für ihn überzeugend sei und große Zustimmung fände, sondern auch, dass es den gegenwärtigen Forschungsstand zur Weiterentwicklung der Schulstruktur wiedergäbe. Die sozialen und schulorganisatorischen Realitäten zeigten, dass systemisch momentan die eine Schule für alle nicht realisierbar sei, wohl aber „die eine Schule für alle, die nicht auf das Gymnasium gehen“, in zweigliedrigen Schulsystemen in fünf Bundesländern Realität sei. Damit würde die Zusammensetzung der Schülerschaft problematisch und zugleich der Anspruch auf Inklusion diskreditiert. Die GGG solle sich aus seiner Sicht offensiv zur Zweigliedrigkeit verhalten, dies auch, um für die benachteiligten Schüler:innen Gelingensbedingungen zu schaffen.
Positiv hob Benjamin Edelstein hervor, dass das Positionspapier die Schulstrukturfrage nicht isoliert behandelt, sondern Schulentwicklungsfragen und Pädagogik mit aufgenommen habe. Die Frage datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung sei unabdingbar für die Förderung und müsse als Unterstützung der besonderen Aufgaben der Schulen des gemeinsamen Lernens aufgefasst werden. Lernende Netzwerke bräuchten zwar Ressourcen, diese würden aber durch Synergieeffekte (Austausch von Konzepten usw.) wettgemacht. Noch stärker ausformuliert sein könne die Frage der Autonomie der Schule. Rollenklarheit auf allen Ebenen wäre enorm wichtig, es dürfe jedoch nicht darauf hinauslaufen, dass die Schulen alleine gelassen werden. Die Schulverwaltung dürfe sich da nicht aus der Affäre ziehen. In dem Papier fehle aus seiner Sicht die Frage der Öffnung der Schulen in ihr Umfeld. Auch das sei eine wichtige Gelingensbedingung.
Insgesamt sei das Positionspapier ein Nordstern, für den es eine Routenplanung brauche, eine Beschreibung der Handlungsfelder, auch der „quick wins“ sowie der Hürden und der Allianzen. B. Edelsteins Kommentar
In der anschließenden Diskussion wurden i.w. strategische Aspekte angesprochen. So die Auseinandersetzung mit der Frage der Zweigliedrigkeit in den Landesverbänden, die erfolgreiche Arbeit an der Basis (Fortbildung, Kontakt zum Ministerium). Die Frage, wie mit Schulformwechslern umzugehen ist und wie man eine „Kultur des Behaltens“ in den Mittelpunkt stellen kann, tauchte immer wieder auf. Neugründungen, Universitätsschulen, Anträge auf Umwandlung, auch das strategische Aspekte. Die Anregung von Edelstein hinsichtlich möglicher Allianzen wurde konkretisiert, mögliche Bündnispartner und Kooperationen genannt. Einhellig wurde der Wunsch unterstrichen, eine Kurzfassung des Positionspapiers „für die Verbreitung in die Hand zu bekommen“.
Besonders erfreulich dann die Abstimmung: Das Positionspapier wurde einstimmig verabschiedet. Das Positionspapier im Wortlaut
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
D. Zielinski: Positionspapier der GGG
Das Positionspapier der GGG: einstimmig beschlossen
hier lesen
Das Positionspapier im Wortlaut Artikel-Download
Ein kurzer Überblick
Dieter Zielinski
In den mehr als 50 Jahren ihres Bestehens hat sich die GGG immer wieder vor dem Hintergrund der jeweiligen bildungspolitischen Situation zur Lage der Schulen des gemeinsamen Lernens und ihrer Entwicklungsperspektiven geäußert. Sie hat dabei stets das Ziel der Umgestaltung des selektiv ausgerichteten deutschen Schulsystems hin zu einem Gesamtschulsystem1 im Blick behalten.
Gegenwärtig befindet sich unser Bildungssystem in einer Krise von bisher nicht gekanntem Ausmaß, was sich an zahlreichen Symptomen festmachen lässt. Dazu gehören u.a. eine gravierende von der sozialen Herkunft abhängige Bildungsungerechtigkeit, die nicht eingelöste Verpflichtung die Inklusion vollständig umzusetzen und ein eklatantes Leistungsversagen. Konsens in gesellschaftlicher und politischer Debatte besteht darin, dass grundsätzliche Reformen im Bildungsbereich erforderlich sind. Für uns bedeutet dies, dass die Zeit reif für die „Eine Schule für alle“ ist. Dass wir mit dieser Forderung nicht alleine stehen, zeigen u. a. Beschlüsse der GEW auf ihrem diesjährigem Gewerkschaftstag sowie der Landesschülervertretungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen.
Im Herbst 2024 befasste sich der Hauptausschuss der GGG erstmals mit der Frage, welche Maßnahmen in dieser Situation dazu beitragen könnten, unserem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. In dem folgenden mehr als einjährigen Prozess entstand schließlich unter Beteiligung aller GGG-Mitglieder das in der Mitgliederversammlung verabschiedete Positionspapier „Zur Weiterentwicklung der Schulen des gemeinsamen Lernens“.
Das Papier hat eine doppelte Zielsetzung. „Nach innen geht es um die Verständigung der GGG auf eine gemeinsame Strategie, nach außen um das Signal, dass die Verwirklichung der „Einen Schule für alle“ wieder auf der Agenda steht und von uns zusammen mit zahlreichen anderen bildungspolitischen Akteuren mit Nachdruck und zeitlicher Perspektive verfolgt wird.“ (Zitat aus dem Positionspapier)
Worum geht es in dem Positionspapier?
Inhaltlich entwickelt das Papier nach einem einleitenden Aufriss der Problemlage in der Einleitung Maßnahmen in Form von Zielvorstellungen und Entwicklungsschritten in drei Handlungsfeldern:
- Positionen zur Weiterentwicklung der Schulstruktur
- Positionen zur Schul- sowie Unterrichtsentwicklung und Pädagogik
- Positionen zur Ausstattung und Personalversorgung der Schulen
Zu 1. Positionen zur Weiterentwicklung der Schulstruktur
Die zentrale Zielvorstellung ist die Verwirklichung des Rechts auf ein inklusives Schulsystem. Beschrieben werden u. a. Schritte des Ausbaus bzw. der Erweiterung des Gesamtschulangebotes sowie strukturelle Erfordernisse der Ausgestaltung der Schulform (Oberstufenangebot für alle Schulen, gebundene Ganztagsschulen, Langformschulen). Pädagogisch orientiert sind die Forderungen nach dem Verzicht auf eine Kategorisierung von Schülerinnen und Schülern, dem Verbot von „Abschulungen“ und der Weiterentwicklung der Schulabschlüsse.
Zu 2. Positionen zur Schul- sowie Unterrichtsentwicklung und Pädagogik
Gefordert wird die Ausrichtung des pädagogischen Handelns an den Stärken der Schülerinnen und Schüler. Damit nicht verträglich sind eine äußere Fachleistungsdifferenzierung sowie Leistungsrückmeldungen in Form von Zensuren. Das gilt nicht nur für die Sekundarstufe I, sondern auch für die Sekundarstufe II . Zur Erreichung der pädagogischen Ziele soll die Eigenverantwortung der Schulen gestärkt und der Austausch zwischen den Schulen durch lernende Netzwerke unterstützt werden. Bejaht wird eine datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung, die dem Lernprozess der Schülerinnen und Schüler dient. Eine missbräuchliche Verwendung solcher Daten im Sinne einer defizitorientierten Diagnostik wird abgelehnt. Schließlich wird die Ermöglichung eines bekenntnisfreien Unterrichts gefordert.
Zu 3. Positionen zur Ausstattung und Personalversorgung
Im Zentrum dieses Handlungsfeldes stehen Forderungen nach einer bedarfsgerechten Finanzierung des Bildungssystems. Dazu gehören eine sozialindexbasierte Verteilung der Ressourcen auf die Schulen, eine Aufhebung des Kooperationsverbotes sowie der Ausbau und die Verstetigung der Digitalisierung. Gefordert wird zudem eine aufgabenadäquate, den Erfordernissen einer inklusiven Schule angepasste Personalversorgung mit allen dazu erforderlichen Professionen. Eine Weiterentwicklung der Schulen im Sinne des Positionspapieres erfordert schließlich auch eine Neuausrichtung der Lehrkräftebildung, die sich an den Lernbedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler sowie den Anforderungen einer inklusiven Schule orientiert.
Das Positionspapier schließt mit dem Fazit, dass die GGG grundsätzlich die Umgestaltung des deutschen Schulsystems in ein Gesamtschulsystem fordert. Als Voraussetzungen dafür werden genannt:
- die überzeugende Arbeit der Schulen des gemeinsamen Lernens,
- die gesellschaftliche Zustimmung sowie
- der politische Wille zu den erforderlichen Entscheidungen.
Das Papier endet mit den Sätzen: „Damit werden der soziale Zusammenhalt und unser freiheitlich-demokratisches System gestärkt. Ein Gesamtschulsystem ist die Grundlage von Bildungsgerechtigkeit in der Demokratie.“
Das Papier wurde am 27.09.2025 einstimmig von der Mitgliederversammlung in Bad Sassendorf beschlossen.
1 Der Begriff Gesamtschule umfasst alle Schulen des gemeinsamen Lernens. Diese heißen in den unterschiedlichen Bundesländern Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Integrierte Sekundarschule, Oberschule und Stadtteilschule. Sie zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass sie sich als inklusive Schulen verstehen, die zu allen Abschlüssen führen.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
EinBlickPolitik
P. Ehrich, U. Reinartz: John Hattie zum deutschen Schulsystem
und zum Lernen mit Künstlicher Intelligenz
Eine fundierte Kritik am Deutschen Schulsystem und ein Ausblick auf erweiterte Lernmöglichkeiten und Anforderungen mit KI.
hier lesen
Artikel-Download englischer Originaltext Quellen/References
Peter Ehrich und Ursula Reinartz führten ein Schreibinterview mit John Hattie durch
Wir freuen uns außerordentlich und sind sehr dankbar, dass wir in dieser Ausgabe ein Schreibinterview mit dem neuseeländischen Professor John Hattie veröffentlichen dürfen, in dem er unsere Fragen zu einer Verbesserung des Schulsystems in Deutschland und zur Bedeutung von Künstlicher Intelligenz für das Lernen beantwortet.
Es bedarf offensichtlich des Blickes vom anderen Ende der Welt, um festzustellen, dass unser Schulsystem in Deutschland mit seiner drei- bis viergliedrigen Struktur nicht das allein-heilbringende ist. „Lasst uns ernsthaft das Tracking beenden: Kein Schüler gewinnt“, so John Hattie in unserem Interview.
Mit Digitalität und Künstlicher Intelligenz gelangen neue Wirkungsfaktoren in Schule und Bildung hinein, die weitreichende Möglichkeiten für inklusives und selbstbestimmtes Lernen eröffnen, aber auch neue Anforderungen an die Selbstverantwortung für das Lernen für die Schüler:innen selbst stellen.
Lieber Professor Hattie, …
1. In einem Interview haben Sie gesagt, dass das deutsche Schulsystem das ungerechteste sei, dem Sie je begegnet sind. Basierend auf Ihrer Forschung zu effektivem Lehren und Lernen: Welche Eigenschaften sollte ein Schulsystem haben, um das Lernen so gerecht und effektiv wie möglich zu gestalten?
Die OECD-PISA-Berichte heben hervor, dass die Bildungsungleichheit in Deutschland besonders ausgeprägt ist, insbesondere hinsichtlich des starken Zusammenhangs zwischen den Bildungsergebnissen der Schüler und ihrem sozioökonomischen Hintergrund. Beispielsweise heißt es: „Die OECD stellte fest, dass die schulischen Leistungen in Deutschland stärker mit der sozialen Herkunft korrelieren als in den meisten anderen Ländern.“ Seit dem starken Anstieg der Zuwanderung in den Jahren 2015/16 wurde diese Problematik noch verstärkt, da viele dieser Schüler ebenfalls aus sozioökonomisch benachteiligten Familien stammen.
Im PISA-Länderbericht Deutschland wird festgestellt: „Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund ist in Deutschland im Jahr 2022 auf 26 % gestiegen (2012: 13 %). … Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland weisen tendenziell ein benachteiligteres sozioökonomisches Profil auf als nicht zugewanderte Schüler; während 25 % aller Schüler als sozioökonomisch benachteiligt gelten, liegt der entsprechende Anteil bei Schülern mit Migrationshintergrund bei 42 %. Rund 63 % der Schüler mit Migrationshintergrund (und 5% aller übrigen Schüler) gaben an, dass die Sprache, die sie zu Hause am häufigsten sprechen, sich von der Sprache unterscheidet, in der sie den PISA-Test absolvierten.“
In Mathematik lag der durchschnittliche Leistungsunterschied zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund bei 59 Punkten zugunsten der nicht zugewanderten Schüler – ein erheblicher Unterschied. Nach Prüfung des sozioökonomischen Profils der Schüler verbleibt ein signifikanter Unterschied von 32 Punkten zugunsten der nicht zugewanderten Schüler. Im Bereich Lesen betrug der durchschnittliche Leistungsunterschied 67 Punkte zugunsten der nicht zugewanderten Schüler. Nach sozioökonomischer Anpassung verblieben immer noch 40 Punkte Differenz.
Da nur etwa die Hälfte der Schüler mit Migrationshintergrund ([von insgesamt] 34 %) eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen, gegenüber 61 % der nicht zugewanderten Schüler, ist zu erwarten, dass sich die Ungleichheiten in Bildung – und damit auch in Einkommensvorteilen und Lebenschancen – in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken werden
Meine Forschung (Hattie, 2023) basiert auf 14 Studien zu Tracking und Leistungsdifferenzierung, die sich allerdings überwiegend auf die Differenzierung innerhalb einer Schule beziehen und insgesamt nur sehr geringe Effekte zeigen (d = 0,09).(1)
Steenbergen-Hu et al. (2016) analysierten 13 Meta-Analysen, die belegten, dass Schüler keinen Vorteil aus der Gruppierung in verschiedene Klassen [Tracking] zogen (-0,03). Die Auswirkungen unterschieden sich nicht für Schüler mit hohem (0,06), mittlerem (0,04) oder geringem (0,03) Leistungsvermögen. Tracking hat minimale Auswirkungen auf die Lernleistungen – niemand profitiert wirklich. Auch in Mathematik und Lesen sind die Effekte zu vernachlässigen (Lesen d = 0,00; Mathematik d = 0,02). Tracking innerhalb einer Schule kann erhebliche Nachteile für die Chancengleichheit haben: Überproportional häufig werden Kinder aus niedrigen sozioökonomischen Schichten sowie benachteiligte Minderheiten in niedrigere oder nicht studienqualifizierende Bildungsgänge gesteckt (Hanushek & Woessmann, 2006; Oakes et al., 1992).
Schulen mit einem höheren Anteil an Minderheiten und sozioökonomisch benachteiligten Schülern bieten seltener ein ausreichendes Angebot an höher qualifizierenden Kursen, wodurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass diese Schüler höhere Bildungswege einschlagen können (Caro et al., 2009; Ferrer-Esteban, 2016). Hanushek und Woessmann (2006) kamen zu dem Schluss, dass eine frühe Sortierung nach Leistung [Tracking] die Bildungsungleichheit vergrößert, dass sowohl Leistungsschwache als auch Leistungsstarke darunter leiden und dass Tracking die soziale Herkunft weiter verstärkt – eigentlich sollte ein Schulsystem das Gegenteil anstreben.
Lasst uns ernsthaft das Tracking beenden: Kein Schüler gewinnt!
2. Angesichts der aktuellen Lage: Welchen Rat geben Sie Lehrkräften, Bildungsexperten, Eltern und Bildungsfachleuten, um das deutsche Schulsystem integrativer und inklusiver zu gestalten?
Es ist mir bewusst, dass es eine sehr einflussreiche Lobby gibt, die das aktuelle „Sortiermodell“ verteidigt – viele der heutigen „Gewinner“ im Erwachsenenleben waren Absolventen des Gymnasiums. Dennoch muss sich das Land fragen, wie es möglich ist, bereits Zehnjährigen zukünftige Erwerbschancen und Lebenschancen vorherzusagen. Dies soll keine Abwertung der Qualität der beiden anderen Schulformen bedeuten, aber der Zugang zu Universitäten etc. erweist sich für Gymnasiasten als deutlich leichter.
Eine spätere Sortierung würde helfen (wenigstens etwas), und die Einführung neuer Schulen, die alle drei Schulformen in einer Institution vereinen, wären hilfreich – vorausgesetzt es gibt flexible Wechselmöglichkeiten.
Es ist unwahrscheinlich, dass Tracking von einer übergeordneten politischen Ebene verändert wird. Aber einzelne Schulen haben sehr wohl die Möglichkeit, gemischte Lerngruppen einzurichten und die Diskussion von „Wer bekommt Zugang zu was und wer wird ausgeschlossen“ auf eine Debatte über Unterrichtsqualität und Lernerfolg zu fokussieren. (Siehe das Beispiel des Schweizer Kantons Bern, wo das Bildungsgesetz diese Flexibilität ermöglicht.)
Pekkarinen (2014) fand, dass ein Verschieben der Trennung nach Bildungsgängen [Tracking], bis die Schüler älter sind, zu mehr sozialer Mobilität und besseren Einkommenschancen über Generationen hinweg führt.
Er warnte jedoch davor, dass es kein Allheilmittel sei, die Entscheidung über die Einstufung in Bildungsgänge einfach auf später zu verschieben – dies möge zwar zu mehr Fairness führen, aber unabhängig vom Einstufungssystem müsse ja immer auf die Auswirkungen auf die Qualität von Unterricht und Lernen geachtet werden.
Meghir und Palme (2005) und Pekkarinen et al. (2006) untersuchten den finnischen Wechsel hin zu einer späteren Sortierung und stellten fest, dass eine spätere Trennung nach Schultyp zu weniger Ungleichheit am Arbeitsmarkt führte. Matthewes (2021) zeigte in einer neueren Studie zum deutschen gegliederten Schulsystem, „dass Schülerleistungen steigen, wenn nicht akademisch orientierte Schüler zwei weitere Jahre nicht nach Leistung getrennt unterrichtet werden, sondern zwei weitere Jahre gemeinsam“ (p. 1304) — insbesondere bei den leistungsschwächeren Schülern. Sie fand heraus, dass Bundesländer, die vom dreigliedrigen auf ein zweigliedriges System umstiegen, bessere und gerechtere Ergebnisse erzielten. Ihr Fazit: „Meine Ergebnisse mahnen zur Vorsicht vor früher und starrer vertikaler Leistungssortierung in Schulen – dies gilt für alle schulformübergreifende Formen von Leistungssortierung“ (p.1304).
Da einige Gewerkschaften ebenfalls nach Bildungswegen organisiert sind, müssen sie sich die größere Frage stellen, was für Deutschland in den nächsten Jahrzehnten am besten ist — wenn die zunehmende Einwanderung und der damit verbundene niedrigere sozioökonomische Status vieler dieser Familien, die überwiegend nicht das Gymnasium besuchen, für die Nation noch zentraler werden (und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Zugang zu tertiärer Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten besteht). Vielleicht müssen sie sich fragen, wie ihr bevorzugtes Modell auf noch mehr Schüler ausgeweitet werden könnte. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Schüler einen Hochschulzugang benötigen oder wünschen. Gesamtschulen weltweit tragen diesem Thema jedoch umfassend Rechnung.
Gute Lehrer können alle Schüler unterrichten, nicht nur die zuvor Sortierten.
3. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind ohne Frage aktuell und absehbar die prägendsten Transformationskräfte, die Schulen beeinflussen. Inwieweit können Digitalisierung und KI individuelles und heterogenes Lernen fördern?
Ich erwarte, dass KI, wie auch die Computertechnik, zunächst nur langsam Einzug in Schulen hält und das Wesen des Unterrichts verändern wird. Schüler werden jedoch zu eifrigen Anwendern (sowohl im positiven als auch im negativen Sinne), was womöglich zu mehr Verboten oder Einschränkungen führen dürfte. Entscheidend für Lehrkräfte ist es daher, jene Kompetenzen zu identifizieren, die für eine effektive KI-Nutzung durch Lehrende und Lernende erforderlich sind.
Nach wie vor gibt es Lehrkräfte, die täglich 150–200 Fragen stellen, mit Antwortmöglichkeiten unter drei Wörtern, meistens über Fakten. Und in fast allen Fällen wissen die Schüler, dass die Lehrkräfte eigentlich die richtige Antwort kennen. Die Schüler hingegen stellen wenige Fragen zu ihrer eigenen Arbeit, deren Antwort sie noch nicht kennen. KI verlangt Kompetenzen im Formulieren von vertiefenden, weiterführenden und fachspezifischen Fragen.
Ein weiteres Beispiel: Wer ist heute für die Qualitätssicherung im Unterricht zuständig? Der Lehrer entscheidet über Thema, Ablauf, Präsentation, Aktivitäten, Tests, Zeitaufwand, Möglichkeiten zur Wiederholung, Bewertungskriterien, Noten, Rückmeldungen. Wenn Schüler KI benutzen, dann müssen sie lernen, ihre eigene Qualitätskontrolle zu übernehmen – zu wissen, wo und wie man Hilfe findet, wie man Fehler erkennt, und wie man entscheidet, ob eine Antwort richtig, falsch oder gut genug ist.
Ebenso sollten vernünftige und ethische Maßstäbe im Umgang mit KI vermittelt werden. Wir brauchen eine konstruktive Debatte über Schutzmechanismen (“Guardrails“) und die benötigten Kompetenzen – und wir müssen dringend dahin kommen, diese zu vermitteln. Vor zehn Jahren, mit der rasanten Ausbreitung von Social Media, gab es diese Debatten nicht, und das wirkt sich heute negativ aus.
4. Welche Chancen und Risiken sehen Sie bei aktuellen technologischen Entwicklungen für die Sicherung von Teilhabe und individualisierter Förderung in heterogenen Lerngruppen?
Ich sehe enorme Möglichkeiten und große Risiken. Über die Risiken und den Bedarf an Schutzmechanismen haben wir bereits viel geschrieben (siehe https://osf.io/preprints/edarxiv/372vr_v1). Wir erforschen aktuell, welche Kompetenzen ein effektiver KI-Einsatz erfordert. Viele Schüler sind bereits jetzt sehr aktive Nutzer von KI – jedoch nicht unbedingt für das schulische Lernen.
Gleichzeitig bedeutet Individualisierung auch, von KI unterrichtet zu werden (siehe z. B. https://www.khanmigo.ai). Ein Vorteil: Diese Systeme haben eine endlose Geduld – man kann dieselbe komplexe Frage mehrfach stellen und nach verschiedenen oder besseren Antworten fragen; man kann sie bitten, drei bis vier unterschiedliche Lösungswege aufzuzeigen; man kann sie nutzen, um Feedback zu erhalten (siehe dazu unseren Artikel: https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2021.645758/full).
Man kann seine Arbeiten einfügen, auf Fehler und Missverständnisse analysieren und gezielt Mini-Lektionen dazu generieren lassen. Man kann mit KI die eigene Lernentwicklung individuell nachverfolgen und sich die besten weiteren Lernschritte empfehlen lassen.
Schüler müssen jedoch lernen, sich auf diese Weise mit KI auseinanderzusetzen, um sich anschließend mit evaluativem Denken zu befassen (wie oben beschrieben). Und auch Lehrkräfte sollten lernen, wie sie diese Fortschritte sinnvoll in den eigenen Unterricht einbinden, und wie sie kollaboratives Lernen mit KI unterrichten. Denn es ist faszinierend, dass die Wirkung von Computer-Technologie viel höher ist, wenn zwei – nicht einer, nicht drei oder mehr — Schüler gemeinsam an technologiebasierten Aufgaben zusammenarbeiten.
Es geht am Ende weniger um die KI als vielmehr um qualitativ hochwertigen Unterricht und das Lernen, das mithilfe von KI und anderen Tools stattfinden kann, um die Liebe zum Wissen und um ein vertieftes Verständnis. Es geht vielmehr um die Lernumgebung, die Klarheit der Lernziele und Erfolgskriterien, die Vermittlung von Lernstrategien, die zum richtigen Zeitpunkt im Lernzyklus eingesetzt werden können, die Auswirkungen der Wahl der Lehrmethoden und Unterrichtspläne, den Feedback-Dialog zwischen Schülern und Lehrern (und KI) – all dies fassen wir in unserem aktuellen Buch zusammen: Illustrated Guide https://tinyurl.com/Hattie-Leitfaden.
–––
Das Quellen- und Literaturverzeichnis und die Originalausgabe des Schreibinterviews auf Englisch finden sich auf unserer Website www.ggg-web.de.
Dieses Schreibinterview mit John Hattie haben wir als Redaktion mit Unterstützung von KI übersetzt, einschließlich der zitierten Passagen. Evtl. Übersetzungsfehler liegen ausschließlich in unserer Verantwortung.
Wir waren dabei bemüht, John Hattie möglichst originalgetreu zu Wort kommen zu lassen. Hervorhebungen im Text erfolgten durch die Redaktion.
(1) Erläuterung der Redaktion: Hattie setzt eine relevante Effektstärke erst ab d=0,40 an:
John Hattie, Visible Learning 2.0, besorgt von Stephan Wernke und Klaus Zierer, Baltmannsweiler 2024, S. 25f.
Erläuterungen von Begriffen
- Tracking:
- - Äußere Differenzierung innerhalb einer Schule (within-school tracking)
- - Bildungsgangzuweisung zwischen Schultypen (between-school tracking)
- Streaming:
- - Klassenübergreifende Gruppierung nach Leistungsniveau, wie sie in der deutschen Gesamtschulpraxis durch G- und E-Kurse realisiert wird.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
ImFokus
Zum Herunterladen steht Ihnen die ganze Rubrik imFokus mit allen Artikeln zur Verfügung.
F. Nuxoll: KI – Prozess oder Produkt
Warum KI die Pädagogik vor eine Grundsatzentscheidung stellt
KI braucht klassische Kompetenzen und eine andere Lernkultur
hier lesen
Florian Nuxoll
Künstliche Intelligenz ist das mächtigste Werkzeug, das je in die Hände von Schülerinnen und Schülern gelangt ist. Doch während die einen damit ihr Lernen auf ein neues Level heben, drohen andere, wichtige Kernkompetenzen zu verlernen. Gerade für Gesamt- und Gemeinschaftsschulen mit ihrer heterogenen Schülerschaft wird diese Entwicklung zur Zerreißprobe – und offenbart zugleich eine unerwartete Chance für uns Lehrkräfte.
Jeder von uns kennt den Pakt, den uns Technologie im Alltag anbietet: Komfort gegen Fähigkeit. Die Übersetzungs-App liefert uns auf Reisen den perfekten Satz und lässt dafür unseren aktiven Wortschatz verkümmern. Die Autokorrektur bügelt jeden sprachlichen Fehler aus und schwächt dabei schleichend unser Gespür für Rechtschreibung und Grammatik. Es ist ein leiser, aber stetiger Tausch von kognitiver Mühe gegen digitale Effizienz.
Mit dem Aufkommen generativer KI erreicht dieser Tauschhandel nun die Klassenzimmer und macht den Lernenden ein radikales Angebot: „Ich gebe dir das (sehr) gute Ergebnis – das ausgearbeitete Referat, die schlüssige Analyse, das „kreative“ Gedicht –, und du gibst mir dafür nur deinen Lernprozess.“ Was im Alltag ein nützlicher Kompromiss sein mag, stellt in der Schule das Fundament des Lernens grundlegend infrage.
Der feine Unterschied: Warum "Deskilling" nicht gleich "Skill-Skipping" ist
In der Arbeitswelt ist der technologiebedingte Fähigkeitsverlust seit Langem als „Deskilling“ bekannt. Er beschreibt, wie Maschinen und Automatisierung die Notwendigkeit menschlicher Expertise reduzieren. Ein Schreinergeselle musste einst Holzarten und Werkzeuge im Detail kennen. Der Bediener einer computergesteuerten Fräse in der Möbelindustrie benötigt vor allem die Fähigkeit, eine Software zu steuern. Die handwerkliche Kunst wurde z.T. an die Maschine ausgelagert.
Hier müssen wir eine grundlegende Unterscheidung treffen, die den Kern des schulischen Dilemmas ausmacht. In der Arbeitswelt zählt primär das Produkt. Was interessiert es uns, ob ein Statiker die Stabilität eines Hauses per Kopfrechnen, mit Excel oder einer KI berechnet? Das Haus soll am Ende sicher stehen. Das Ergebnis rechtfertigt die Effizienz des Weges.
Im Lernprozess hingegen verkehrt sich diese Logik ins Gegenteil. Hier ist der Prozess das eigentliche Produkt. Der Weg ist das Ziel. Das mühsame Recherchieren, das Ordnen der Gedanken, das Ringen um die richtige Formulierung, die Frustration über eine Sackgasse und der "Aha-Moment" der Lösung – all das ist der Kompetenzerwerb. Wenn nun die KI diesen gesamten Prozess übernimmt, findet kein Deskilling im klassischen Sinne statt, sondern etwas viel Gefährlicheres: „Skill-Skipping“. Der wertvolle, lernintensive Hindernislauf des Lernens wird übersprungen. Die KI wirkt wie eine Planierraupe, die eine hindernisfreie Autobahn direkt zum fertigen Produkt schafft und den Lernenden damit um die wichtigste Erfahrung betrügt: die eigenständige Überwindung von Schwierigkeiten.
Deskilling als Chance: Wie KI die Lehrkraft entlastet
Während „Skill-Skipping“ also den Kompetenzerwerb der Lernenden untergräbt, entpuppt sich das Prinzip des „Deskilling“ für uns Lehrkräfte als enorme Chance. Unsere Arbeit ist, genau wie die des Statikers, auf ein Produkt ausgerichtet: gut vorbereiteten, differenzierten Unterricht. Der Weg dorthin darf und sollte so effizient wie möglich sein.
In der täglichen Praxis von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen, wo die Heterogenität der Klassen eine permanente Herausforderung darstellt, kann KI zum entscheidenden Werkzeug für die Binnendifferenzierung werden. Stellen Sie sich vor, ein komplexer Fachtext zum Wasserkreislauf soll für eine 7. Klasse aufbereitet werden. Bisher bedeutete das: zeitintensives Vereinfachen, Umformulieren, Erstellen verschiedener Versionen. Heute kann die KI diese Arbeit in Sekunden erledigen:
- Sie fasst den Originaltext auf drei unterschiedlichen Niveaus zusammen.
- Sie übersetzt eine Version in Leichte Sprache.
- Sie generiert zu jedem Textverständnis passende Kontrollfragen und Vokabellisten.
Die Lehrkraft wird dabei nicht überflüssig, ihre Rolle wandelt sich aber von der mühevollen Materialerstellerin zur qualitätsprüfenden Kuratorin und pädagogischen Begleiterin. Wir nutzen die Effizienz der Maschine, um mehr Zeit für das Wesentliche zu haben: die direkte Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Hier ist Deskilling ein Segen.
KI: Spalter oder Chancengeber?
Kehren wir jedoch zurück zu den Lernenden, offenbart sich die Gefahr dieses zweischneidigen Schwertes. Gerade in unseren heterogenen Klassen wirkt die KI wie ein Brandbeschleuniger für den „Schereneffekt“. Die zentrale Frage lautet: Wird sie zum großen Gleichmacher oder zum ultimativen Spalter?
Die Gefahr ist real, dass sich die Kluft zwischen intrinsisch motivierten und rein pflichtbewussten Schülerinnen und Schülern dramatisch vergrößert.
- Für die engagierte Schülerin, die für ihr Geschichtsreferat über die Hanse brennt, wird die KI zum persönlichen Super-Tutor. Sie kann sich komplexe Handelsrouten erläutern lassen, nach den Ursachen für den Niedergang fragen und ihre Thesen von der KI auf Stichhaltigkeit prüfen lassen. Ihr Lernprozess wird reicher und tiefer.
- Für den pragmatischen Schüler, der die Aufgabe nur schnell erledigen will, wird dieselbe Technologie zum „Erledigungs-Automaten“. Ein paar Stichworte genügen, und die KI liefert eine vorzeigbare Präsentation. Das Ergebnis mag passabel sein, der Lerneffekt ist jedoch gleich null. Hier findet pures Skill-Skipping statt.
Der entscheidende Faktor bleibt die Motivation. Ohne ein echtes Interesse oder den klaren Anreiz, einen Inhalt wirklich verstehen zu wollen, wird jedes Werkzeug primär zur Abkürzung missbraucht.
Wie wir dem "Skill-Skipping" pädagogisch begegnen
Wenn der individuelle Antrieb entscheidet, kann sich Schule nicht allein darauf verlassen. Die strukturelle Antwort muss die Lernkultur verändern und den Fokus verschieben. Drei Handlungsfelder sind hier entscheidend:
- Didaktik: Den Prozess ins Zentrum rücken. Die Bewertung muss sich vom reinen Produkt lösen. Statt nur das fertige Referat zu benoten, können wir den Entstehungsprozess bewerten: die erste Gliederung, die überarbeiteten Entwürfe, die Reflexion über die genutzten Quellen. Prozessorientierte Leistungsformate wie Lerntagebücher, Portfolios oder die verpflichtende Abgabe der „Reflektion der KI-Nutzung“ machen den Lernweg sichtbar und bewertbar. Das ist aber natürlich sehr zeitaufwendig und kann von generativer KI ebenfalls simuliert werden.
- Organisation: Analoge Lerninseln schaffen. Die ständige Verfügbarkeit der KI auf Laptops und Tablets macht eine bewusste Selbstregulation für viele Jugendliche zur Illusion. Schulen müssen verbindliche Zeiten und Räume für das Lernen ohne digitale Endgeräte schaffen – Phasen des konzentrierten Lesens, des handschriftlichen Notierens und des ungestörten, tiefen Denkens, in denen das Gehirn nicht auf den schnellen Ausweg per Mausklick trainiert wird.
- Curriculum: KI-Kompetenz als Bildungsziel verankern. Die Fähigkeit, KI reflektiert und produktiv zu nutzen, ist eine Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Der kritische Umgang mit KI, das grundlegende Verständnis ihrer Funktionsweise (inklusive algorithmischer Bias) gehören als neue Kulturtechnik fest in die Lehrpläne. Dies ist auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, denn so stellen wir sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet werden.
Die KI geht nicht wieder weg. Unsere Aufgabe ist es, einen pädagogischen Rahmen zu schaffen, in dem sie das tut, was sie am besten kann: uns Lehrkräfte entlasten und für motivierte Lernende ein unschätzbar wertvoller Partner sein. Verhindern müssen wir jedoch, dass sie für andere zum Totengräber des echten Lernens wird.
P.S.: Ein letzter Gedanke zur vieldiskutierten „Prompt-Kompetenz“
Oft wird der Eindruck erweckt, das „Prompten“ sei eine neue, hochkomplexe Kulturtechnik, die es mühsam zu erlernen gilt. Die Realität ist jedoch, dass wir gerade Zeugen eines paradoxen Prozesses werden: Die Fähigkeit des anspruchsvollen „Prompt Engineerings“ ist durch die KI selbst von Deskilling betroffen.
Die ersten Generationen von KI-Modellen waren oft sperrig und erforderten präzise, fast code-ähnliche Befehle, um brauchbare Ergebnisse zu liefern. Heutige Systeme sind jedoch darauf trainiert, natürliche Sprache, Intentionen und den Kontext eines Gesprächs zu verstehen. Sie wollen keine starren Befehlsketten, sondern ein Dialogpartner sein.
Die entscheidende Kompetenz verschiebt sich daher weg von der technischen Eingabe hin zu einer zutiefst menschlichen und uns wohlbekannten Fähigkeit: Man muss nur noch einigermaßen klar, kohärent und strukturiert sagen oder schreiben können, was man möchte. Es geht nicht mehr darum, die Sprache der Maschine zu lernen, sondern darum, die eigenen Gedanken zu beherrschen.
Wer eine unklare Frage stellt, weil er den Sachverhalt selbst nicht durchdrungen hat, erhält von der KI eine ebenso vage oder unbrauchbare Antwort. Wer jedoch in der Lage ist, ein Problem zu analysieren, sein Ziel präzise zu formulieren und seine Anfrage logisch aufzubauen, wird exzellente Ergebnisse erzielen. Im Kern stärkt die fortschreitende KI also die Bedeutung klassischer Kompetenzen: präzises Ausdrucksvermögen, strukturiertes Denken und eine klare Argumentationsfähigkeit. Unsere Aufgabe ist es also weniger, eine neue technische Fähigkeit zu vermitteln, sondern vielmehr, die grundlegenden intellektuellen Kompetenzen zu schärfen, deren Wert im Dialog mit der KI sichtbarer und wichtiger wird als je zuvor. Die eigentliche Kunst liegt nicht in der Ansprache der Maschine, sondern in der Klarheit des eigenen Gedankens.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
O.-A. Burow: Schule der Zukunft in Zeiten von KI
Sieben Handlungsoptionen für mehr Bildungsgerechtigkeit
Digitalisierung – eine Chance zur Erweiterung des schulischen Möglichkeitsraums
hier lesen
Olaf-Axel Burow
Die Gemeinschaftsschule steht vor einer historischen Chance: Digitalisierung kann das Versprechen einer gerechteren Bildung endlich einlösen. Während das gegliederte Schulsystem laut John Hattie "das ungerechteste System" darstellt, das er kenne, eröffnen KI-gestützte Lernplattformen völlig neue Perspektiven für personalisierte Förderung.
Doch Hatties bildungswissenschaftliche Kritik erhält durch die medizinische Forschung eine verstörende Dimension: Wie ich in meiner neuen Studie "Verlorene Zukunft" (Burow 2025) zeige, ist die Lage noch dramatischer. Der britische Epidemiologe Michael Marmot belegt in dramatischer Weise: "Bildungsbenachteiligung tötet in großem Stil" — Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen haben eine um bis zu 28 Jahre verringerte Lebenserwartung. Diese beunruhigende Erkenntnis hat mich dazu veranlasst zu recherchieren, was wir tun können, um in systemischer Perspektive ein gerechteres Bildungssystem zu gestalten.
Sieben Handlungsoptionen für die digitale Gemeinschaftsschule
Digitalisierung kreativ nutzen
Digitalisierung ist der Megatrend, denn alles, was digitalisierbar ist, wird in absehbarer Zeit digitalisiert werden. Spätestens seit der Freischaltung von ChatGPT im November 2022 wird unser aller Alltag durch das rasante Vordringen der LLMs (sprich sprachbasierte KI-Modelle wie Chat GPT) beeinflusst — mit dramatischen Folgen für das tradierte Modell der Unterrichtsschule.
Schon heute geht es immer weniger allein um Wissensvermittlung, da wir durch digitale Technologien permanent mit Wissen umstellt sind. KI-gestützte Systeme wie die Lern-App Khanmigo fungieren als "sokratische Tutoren", die Lehrkräfte nicht nur bei der Erstellung von Unterrichtsinhalten entlasten, sondern auch Schüler in personalisierter Form begleiten können.
Mehr noch: Mit Hilfe digital unterstützter Systeme ist nicht nur der Abschied vom Zeitalter der nivellierenden Massenpädagogik möglich, sondern damit eröffnet sich auch ein dringend benötigtes Zeitfenster für kreativ-künstlerische Projekte in Designwerkstätten, Tanz-, Theater- und Musikprojekten oder Makerspaces. Aus dieser Perspektive sind digital und analog keine Gegensätze, sondern können einander ergänzen und den schulischen Möglichkeitsraum erweitern.
Talente und Neigungen stärken
Dabei gilt es zu verstehen: In einer arbeitsteilig organisierten, ausdifferenzierten Gesellschaft geht es — anders als zu Zeiten der industriellen Massenproduktion — immer weniger darum, dass alle das gleiche können, sondern stärker darum, dass jeder etwas Besonderes kann. Wie ich in "Team-Flow" (Burow 2015) anhand der Nachverfolgung von Lebensläufen erfolgreicher kreativer Persönlichkeiten gezeigt habe, bedarf es entwicklungsförderlicher, vernetzter Umgebungen.
Hierzu bedarf es leidenschaftlich engagierter Lehrkräfte, die in der Lage sind, mit ihren Schülern auf Augenhöhe zu kommunizieren — so die Erkenntnis des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie.
Neue Bildungsräume erschließen
Doch personalisierte Förderung erfordert auch veränderte Lernumgebungen. Die auf militärische Kasernenbauten zurückgehende Flurschule wird den neuen Anforderungen nicht gerecht. Wenn Lernen zeit- und ortsunabhängig mithilfe interaktiver digitaler Geräte jederzeit und vielfältig vernetzt möglich ist, dann erfordert dies veränderte Lehr-Lerndesigns.
Doch "neue Bildungsräume" meint mehr als Architektur und Mobiliar, sondern bezieht sich — etwa im Rahmen eines rhythmisierten Ganztags — auch auf die Nutzung außerschulischer Lernorte und vielfältige Kooperationen mit Partnern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Umfeldern.
Agile Schulkultur gestalten
Ob es um den Ausbau der digitalen Infrastruktur oder Gestaltung neuer Lehr-, Lern- und Prüfungsformate geht — der Amtsschimmel wiehert in Deutschland und behindert Lösungsversuche aus eigener Kraft. Deutsche Schulen können nur in ca. einem Fünftel aller Fragen selbstständig entscheiden.
Von daher scheint es, neben der dringend gebotenen Entbürokratisierung, sinnvoll, geeignete Elemente agiler Führung auch auf die Leitung von Schulen zu übertragen. Die anstehende "Große Transformation" der Gesellschaft macht es notwendig, dass Schule zu einer permanent sich wandelnden "Lernenden Organisation" wird.
Gesundheit und Resilienz sichern
Diese organisatorischen Veränderungen müssen die menschliche Dimension berücksichtigen. Studien belegen in dramatischer Weise: 51% der Schüler assoziieren Schule mit "Zwang und Druck", nur 23% erfahren "Spaß". Angesichts solcher empirisch belegten Erkenntnisse kann es ratsam sein, die Perspektive zu wechseln.
Beim Münsteraner Begabungskongress 2025 brachte Joseph Renzulli das auf die einfache Formel: "Everything begins with Interest, Enthusiasm, Engagement, Enjoyment".
Demokratie und Gerechtigkeit leben
Da der "Siegeszug der Autokraten" unser politisches System durch Fehlinformationen bedroht, werden Demokratisierung und die Förderung kritischen Bewusstseins zentral. Hierfür brauchen wir Zeitfenster, in denen man nicht nur über Zukunft philosophiert, sondern im Rahmen entsprechender Projekte Zukunftsgestaltung lernt, zur Not in einem "Schulfach Zukunft", aber besser noch in einen "Frei Day", der im schulischen Curriculum fest verankert sein muss.
Zukunftskompetenz fördern
Dabei gilt es einen Grundirrtum der alten Schule zu überwinden: die Annahme, Wissen sei eine Kompetenz. Kompetenz entsteht erst durch die Verbindung von Wissen, Haltung, Handeln sowie die Befähigung zu Metareflexion. Die vier K — Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation und Kollaboration, Kreativität und Innovation — werden durch digitale Werkzeuge unterstützt.
Digitalisierung als Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit
Insofern besteht ein Schlüssel zur "# Schule der Zukunft" in der Lösung des "Zwei-Sigma-Problems": Benjamin Blooms These von 1984 wird durch KI-Entwicklung Wirklichkeit - "wir können fast jedes Kind — gleich welchen Hintergrunds — zu Spitzenleistungen befähigen, wenn es möglich wäre, ihm einen persönlichen Tutor an die Seite zu stellen".
Wenn inzwischen bis zu 60% der Kinder einen Migrationshintergrund haben, dann wird Diversity zum Regelfall, dem das traditionelle Schul- und Unterrichtsmodell nicht gerecht wird. Digitale Systeme können diesem Regelfall gerecht werden durch digital unterstützte personalisierte Lehr-Lernangebote.
Ganz offensichtlich ist das traditionelle Schulmodell — auch vor dem Hintergrund der sich wandelnden Lebenswelten und der sich rasant entwickelnden Technologie — an seine Grenzen gekommen. Diesen, für eine demokratische Gesellschaft nicht länger zu tolerierenden Zustand, können wir nur überwinden, wenn wir gemeinsam die "# Schule der Zukunft" entwickeln und wirksame Maßnahmen einleiten, um die seit Jahrzehnten andauernde Bildungsungerechtigkeit zu überwinden.
Reparatur des Bestehenden und kosmetische Eingriffe werden nicht ausreichen. Politik, Verwaltung und auch Schulleitungen sollten in diesem Sinn daran arbeiten, Zukunft zu gewinnen — auch unter Einsatz neuester Technologien — mit einer Schule, die nicht weiter nur die ohnehin Privilegierten fördert, sondern allen Lebens- und Teilhabechancen eröffnet, indem sie sie stärkt.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
K. Schneider: Der Deutsche Ethikrat
– eine unabhängige und übergeordnete Institution
Der Deutsche Ethikrat – ein verlässlicher Kompass, auch bei der Digitalisierung
hier lesen
zusammengefasst von Konstanze Schneider
Am 11. April 2008 hat der Deutsche Ethikrat den zuvor bestehenden Nationalen Ethikrat abgelöst. Die Arbeit des Ethikrates beruht auf dem Rahmen, den das Gesetz zur Einrichtung eines Deutschen Ethikrates vorgibt. Er hat 26 Mitglieder aus breit gefächerten Fachgebieten, die zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte von der Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten berufen werden. Neben konkreten Anfragen und Stellungsnahmen legt er jährlich einen Bericht vor.
Der Ethikrat arbeitet unabhängig und hat folgende Aufgaben
- Beratung und Stellungnahmen zu ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen
- Stellungnahmen und Empfehlungen zu aktuellen Themen wie Gendiagnostik, Intersexualität, künstlicher Intelligenz, Patientenwohl und Big Data
- Adressaten der Ergebnisse sind die Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft.
In seiner Veröffentlichung vom März 2023 „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz“ ist die Position des Deutschen Ethikrates zur Digitalisierung und künstlichen Intelligenz dargelegt. Sie ist nach wie vor gültig. Das Leitprinzip lautet: Digitalisierung und KI müssen dem Menschen dienen – nicht umgekehrt. Der Ethikrat sieht in der Digitalisierung große Chancen, warnt aber vor den Risiken für die Demokratie, die Autonomie und Gerechtigkeit.
Die Position des Deutschen Ethikrates
zu Chancen und Risiken von Digitalisierung und KI im Bildungsbereich:
Chancen werden für die individuelle Förderung der Schülerschaft gesehen, da die Lernprozesse personalisiert und auf die jeweiligen Notwendigkeiten des Einzelnen angepasst werden können. Auch die Unterstützung der Lehrkräfte ist ein wichtiger positiver Faktor. Administrative Aufgaben oder reine Fehlerkorrekturen könnten von KI übernommen werden und entlasten. Digitale Tools können den Zugang von bildungsfernen und benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen zur Teilhabe an Bildung erleichtern.
Risiken werden jedoch für die Autonomie und Selbstbestimmung von Lernenden gesehen. Der Ethikrat sieht die Gefahr, dass eine passive und konsumierende Haltung gefördert wird und menschliche Neugier, Kreativität und kritische Reflexion eingeschränkt werden.
Der Schutz von Schüler*innendaten vor Überwachung und Kontrolle muss klar geregelt und beachtet werden, es darf keine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte geben. Wenn nicht alle Schulen gleichermaßen Zugang zu den neuen Bildungstechnologien haben, sieht der Ethikrat die Gefahr, dass die soziale Bildungsungerechtigkeit verstärkt werden könnte.
Die Empfehlungen des Ethikrates zu Digitalisierung und KI in der Schule sind eindeutig:
- Die Entscheidungen über Lerninhalte und pädagogische Methoden müssen bei Menschen liegen. KI kann Lehrkräfte unterstützen, aber keinesfalls ersetzen.
- Die KI Systeme müssen transparent und nachvollziehbar gestaltet sein, damit sie und ihre Funktionsweise für Lehrkräfte, Schülerschaft und Eltern verständlich sind.
- Digitale Bildung muss immer auch die ethische Reflexion über den Einsatz und die Wirkung von Technologie enthalten. Die Schüler*innen sollen lernen, digitale Medien und KI kritisch zu hinterfragen und verantwortungsvoll zu nutzen.
Link: https://www.ethikrat.org/publikationen/stellungnahmen/mensch-und-maschine/
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
B. Riekmann: Handlungsempfehlungen der KMK
zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz
Die KMK setzt für den schulischen Umgang mit KI einen länderübergreifenden Rahmen
hier lesen
zusammengefasst von Barbara Riekmann
Die Handlungsempfehlung der KMK zum Umgang mit KI in schulischen Bildungsprozessen vom 10.10.2024 widmet sich fünf Themenbereichen.
- Einfluss und Auswirkungen von KI auf Lernen und Didaktik
Aus Sicht der KMK soll der Einsatz von KI nicht „zur Abschwächung des gemeinsamen Lernens führen“ (S. 3). Die Lehrkräfte könnten durch KI bei der Gestaltung von Lernsituationen unterstützt werden, indem sie z.B. den Schüler:innen stärker individualisierte Lernunterstützung und neue Aufgabenformate bereit stellten. Auch für regelmäßiges Feedback und Lernstandsdiagnosen seien KI-Anwendungen sinnvoll. Darüber hinaus böte KI vielfältige Möglichkeiten zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ausdrücklich wird die Förderung von kritisch-reflexiven Kompetenzen im Rahmen der Medienbildung herausgestellt, weil Falsch- und Desinformationen gerade hinsichtlich der Demokratiebildung und der Gefährdung demokratischer Strukturen eine hohe Bedeutung zukämen. In einem ersten Schritt sollen die Länder für das Lernen mit KI den Fokus auf die Basiskompetenzen (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) richten.
- Veränderung der Prüfungskultur durch KI
Bereits im Dezember 2021 hatte es die KMK als prioritäre Aufgabe angesehen, eine an der „Kultur der Digitalität ausgerichtete Prüfungskultur zu implementieren“ (S. 6). Mit dem Einzug von KI-Anwendungen wird dieser Auftrag deutlich erweitert. Potentiale und Grenzen, z.B. hinsichtlich der Korrektur von Leistungsnachweisen mithilfe von KI-Anwendungen, müssten abgewogen werden. Letztendlich bliebe die Leistungsbewertung eine menschliche Entscheidung der Lehrenden. Dennoch werden Unterstützungspotenziale bei personalisierten Feedbacks und der Qualitätsverbesserung von schriftlichen Prüfungsaufgaben gesehen. Sollte z.B. im Rahmen einer Präsentation KI genutzt worden sein, sollte die „versierte Ko-Aktivität und die Fähigkeit, die Ergebnisse zu reflektieren, berücksichtigt werden.“(S. 7) Wichtig sei, dass es bei der Bewertung einer Leistung von „der Produkt- hin zur Prozessorientierung“ (S. 7) komme.
- Professionalisierung von Lehrkräften
Empfohlen wird, dass die KI-Kompetenzbildung in alle drei Phasen der Lehrkräftebildung einzubinden sei. Auch technische Grundlagen und rechtliche Aspekte sollen hierbei Berücksichtigung finden. Es gehe beim kontinuierlichen Lernen der Lehrkräfte im Zusammenhang mit den neuen Technologien auch darum, die „notwendigen Ressourcen und Freiräume“ (S. 9) zur Verfügung zu stellen.
- Regulierung
Die KMK hält ein „innovationsoffenes Regulierungs- und Gestaltungskonzept“ (S.10) für erforderlich. Hierfür müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl auf der Ebene der Länder als auch des Bundes unter Beachtung von ethischen Leitlinien (mit Verweis auf den Deutschen Ethikrat) geschaffen werden.
- Zugangsfragen zu generativen KI-Anwendungen im Kontext von Chancengerechtigkeit
Durch einen datenschutzkonformen und kostenfreien Zugang zu LLM i im schulischen Bereich soll der Gefahr einer „digitalen Spaltung“ (S. 11) begegnet werden. Dies nicht allein bezogen auf den materiellen und physischen Zugang zu KI, sondern auch im Hinblick auf die Vielfältigkeit der „Nutzungsmuster“ (S. 11) sowie der Fähigkeiten in Hinblick auf die Qualität der effektiven Nutzung. Die Länder sollen bei der Entwicklung weiterer KI-Anwendungen auf die digitale Teilhabe aller Lernenden achten.
Eine kritische Einordnung zur Handlungsempfehlung von der GEW, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und von Wikimedia Deutschland finden Sie hier:
(1) LLM: Large Language Model, ein KI-basiertes Sprachmodell, das sich durch seine Fähigkeit zur Textgenerierung auszeichnet und dafür riesige Datenmengen verwendet.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
J. Muuß-Merholz: KI – Der neue große Verstärker
„KI“ steht in der Schule für „Krise der Identität“
Digitalisierung und KI als Chance, Schule und Lernen grundsätzlich neu zu denken und zu gestalten
hier lesen
Jöran Muuß-Merholz
Seit einigen Jahren blicke ich mit einer gedanklichen Brille auf die Welt, die mir hilft, das Verhältnis zwischen neuen Medien und neuem Lernen auf grundsätzlicher Ebene zu verstehen und zu erklären. Meine These lautet: Neue Technologien verändern Lernen und Schule nicht von sich aus in eine festgelegte Richtung. Aber digitale Medien wirken als mächtiger Verstärker für eine schon vorhandene Richtung, für bestehende Strukturen, Tendenzen, Interessen oder Prinzipien. Wenn wir ein Lernen fördern, das auf Eigenaktivität, auf Kreativität, auf Zusammenarbeit, auf die Bearbeitung von authentischen Fragen und die Erstellung von Produkten ausgerichtet ist, dann können wir das mit digitalen Medien verstärkt tun. Wenn wir den Lernprozess möglichst stark strukturieren und detailliert kontrollieren wollen, dann können wir auch das mit digitalen Medien verstärken.(1)
Wenn gegenwärtig von Digitalisierung und von künstlicher Intelligenz in der Schule die Rede ist, wird in Debatten häufig beruhigt, es ginge dabei um »nur ein Werkzeug« und selbstverständlich würde »Pädagogik vor Technik« gehen. Meist stillschweigend wird davon ausgegangen, dass wird das System Schule nicht auf grundsätzlicher Ebene in Frage stellen, sondern durch »digital-gestütztes Unterrichten« optimieren und stabilisieren.
Ich halte es für möglich, dass das richtig ist. Es ist denkbar, dass die Stabilität des Systems Schule so groß ist, dass diese Prozesse der gegenseitigen Selbstvergewisserung und graduellen Anpassung tragfähig sind und Schule sich an der Oberfläche verändert und im Wesen stabil bleiben wird. Gleichzeitig können wir es für möglich halten, dass Schule und Lernen im Jahr 2035 grundsätzlich anders aussehen werden als heute. Falls das so ist, dann haben diese Veränderungsprozesse schon begonnen und wir können sie mit etwas Abstand auch erkennen und beschreiben. Darauf aufbauend können wir sie auch beeinflussen und gestalten.
Die neue Technologie stellt uns vor alte Fragen
Ich habe im Laufe der letzten Zeit die folgende Liste mit Fragen notiert, die mir in der Debatte um KI und Bildung häufig so oder ähnlich begegnet sind. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder eine bestimmte Ordnung. Es sind Blitzlichter aus tagesaktuellen (oder jahresaktuellen) Diskussionen.
- KI-getriebene Fragen rund um Lernen, Lehren, Schule und Bildung
- – Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann?
- – Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt?
- – Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen?
- – Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig?
- – Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen?
- – Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient?
- – Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden?
- – KI ist nicht wirklich intelligent, oder?
- – KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder?
- – Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten?
- – Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden?
Alle diese Fragen sind berechtigt und nicht einfach zu beantworten. Und sie haben das Potenzial für mehr, worauf ich gleich zurückkommen möchte. Davor will ich ein Bild aus dem Jahr 1892 hinzuziehen, das uns als Allegorie dienen kann.
Ein Kippbild
Die folgende Abbildung erschien am 23. Oktober 1892 in »Fliegende Blätter«, einer humoristischen deutschen Wochenschrift. Der Künstler ist unbekannt. Es handelt sich um ein sogenanntes Kippbild, in dem man zwei unterschiedliche Tiere erkennen kann.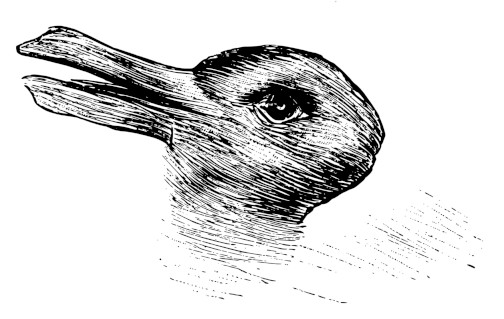
Es ist charakteristisch für Kippbilder wie dieses, dass der Mensch zwei verschiedene Dinge darin sehen kann, aber immer nur eines davon zur selben Zeit. In diesem Fall ist es ein Hasenkopf (mit den Ohren nach links) oder ein Entenkopf (mit dem Schnabel nach links).
Der Philosoph Ludwig Wittgenstein führte die Kippfigur des Hasen-Enten-Kopfes mit einem grundsätzlichen Denkansatz zusammen: Wir Menschen können in dieser Figur »einmal als das eine, einmal als das andere Ding sehen. [...] Wir deuten sie also, und sehen sie, wie wir sie deuten.« Und weiter: »Die folgende Figur […] wird in meinen Bemerkungen H-E-Kopf heißen. Man kann ihn als Hasenkopf oder als Entenkopf sehen. Und ich muss zwischen dem ›stetigen Sehen‹ eines Aspekts und dem ›Aufleuchten‹ eines Aspekts unterscheiden.« (2)
Die Kippfragen der KI-Debatte
Wir können uns bewusst entscheiden, jede KI-getriebene, akute Frage auf ihr Kippbild hin zu untersuchen und die mit ihr verbundene pädagogische, grundsätzliche Frage zu formulieren. Jede Frage nach einer konkreten Reaktion auf den technologischen Wandel können wir als »Kippfrage« umdeuten und anders sehen: als Frage nach unseren Paradigmen und Prinzipien, nach den Zielen und Inhalten, nach dem „WHAT“ und dem „WHY“ von Schule.
Die oben stehende Auflistung von Fragen wird in der folgenden Tabelle auf der linken Seite wiederholt. In dieser Variante habe ich zu jeder Frage in der Spalte rechts daneben eine weitere Frage ergänzt, die nach der Logik des Kippbildes die linke Frage umdeutet: von einer KI-getriebenen, akuten Frage zur pädagogisch begründeten, grundsätzlichen Frage. Es handelt sich quasi um eine Sammlung von »Kippfragen«, die einmal einen Hasenkopf und einmal einen Entenkopf der Diskussionen um KI und Bildung beschreiben.
KI-getriebene, akute Fragen |
Pädagogisch begründete, grundsätzliche Fragen |
|
Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann? |
Wieso muss ich etwas lernen, was Maschinen besser können? |
|
Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt? |
Was ist meine grundlegende Aufgabe als menschliche Lehrperson? Was ist mein Selbstverständnis? |
|
Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen? |
Wofür treffen wir uns zu festen Zeiten in festen Häusern? |
|
Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig? |
Was macht das Wesen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen aus? |
|
Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen? |
Welche Bildungsziele und Inhalte sind wichtig? |
|
Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient? |
Welche Formen des Lernens und Lehrens sind zukunftsgerecht? |
|
Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden? |
Wie gestalten wir Aufgaben und Prüfungen in einer lernförderlichen Weise? |
|
KI ist nicht wirklich intelligent, oder? |
Was bedeutet eigentlich Intelligenz? |
|
KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder? |
Was bedeutet eigentlich Kreativität? |
|
Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten? |
Worauf kommt es in Zukunft im Berufsleben an? Was braucht »die Wirtschaft«? Was braucht »der Mensch«? |
|
Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden? |
Wie gestalten wir Transformationsprozesse von Bildungseinrichtungen? |
Wie in einem Kippbild gibt es auch bei Kippfragen nicht eine falsche und eine richtige Seite. Es handelt sich um dieselben Dinge, die wir jeweils unterschiedlich deuten und entsprechend unterschiedlich sehen können. Aus der tagesaktuellen Dringlichkeit heraus sehen wir in der Regel zuerst die akuten, KI-getriebenen Fragen. Wir können uns aber entscheiden, dabei auch die Fragen zu sehen, die darin »aufleuchten«, wie Wittgenstein sagen würde. Diese Fragen sind dann nicht in der Technik, sondern in der Pädagogik begründet. Sie sind nicht durch Tagesaktualität getrieben, sondern im Grundsätzlichen verankert. Es sind häufig keine einfachen Fragen, deren Beantwortung sich aber lohnt, weil sie eine längere Haltbarkeit haben und wir unsere Debatte ein Stück weit von aktuellen Technologietrends emanzipieren können.
KI = Krise der Identität für die Schule
Wir behaupten in deutschsprachigen Debatten gerne, dass die Pädagogik Vorrang vor der Technik haben sollte. Der Ausgangspunkt aktueller Debatten ist aber häufig die Technik, ob man das mag oder nicht. Der Wechsel zwischen den beschriebenen zwei Perspektiven kann uns helfen, der Verwobenheit von Technik und Pädagogik so komplex zu begegnen, wie es der Gegenstand verlangt. Darin liegt die Chance, dass wir den falschen Antagonismus von Pädagogik und Technik auflösen. Technik ist in KI-Debatten in der Regel Ausgangspunkt der Fragen – und gleichzeitig Teil der Antworten auf gesellschaftliche und pädagogische Fragen. Diese Fragen sind nicht neu, im Gegenteil: Es handelt sich um so alte und so grundsätzliche Fragen, dass wir sie bisweilen als selbstverständlich behandelt bzw. gerade nicht mehr behandelt haben. Die Antworten sind teils verschüttet, teils lange nicht mehr thematisiert, geschweige denn aktualisiert worden. Nun werden die alten Fragen wieder sichtbar. Oder in Wittgensteins Logik: Das Grundsätzliche leuchtet auf, wenn wir das Aktuelle diskutieren. Die Debatte um KI hält uns einen Spiegel vor: Jede Frage nach Technik fordert gleichzeitig Antworten auf die Frage: »Welches Lernen, welches Lehren, welche Schule, welche Bildung wollen wir eigentlich?« Es geht für die Schule um existenzielle Fragen in dem Sinne, dass sie die Grundlagen, die Ziele und das Wesen der Arbeit betreffen. Es geht um das Selbstverständnis der Institution Schule, um die Identität ihrer Mitglieder, um den Sinn ihrer Existenz. Man könnte zuspitzen: Das Kürzel »KI« steht in der Schule auch für »Krise der Identität«.
Digitalisierung und KI stellen uns vor existenzielle Fragen. Das ist anstrengend. Und es bietet eine historische Chance, Schule grundlegend neu zu denken und zu gestalten. Wir müssen uns heute fragen, welche dieser Veränderungen wir mit neuen Technologien verstärken wollen – und welche nicht. In Schulen und Gesellschaft müssen wir uns als gestaltende Akteure der Zukunft begreifen. Wir müssen nicht nur fragen: »Was machen Digitalisierung und KI künftig mit der Schule?«, sondern auch und erst recht: »Was macht die Schule künftig mit Digitalisierung und KI?«
–––
(1) vgl. Jöran Muuß-Merholz (2019): Der große Verstärker. Spaltet die Digitalisierung die Bildungswelt. Aus Politik und Zeitgeschichte, 69, S. 4-10. Oder als kurzer Videovortrag: Jöran Muuß-Merholz (2021): Der große Verstärker. Was macht die Bildung mit der Digitalisierung? Ein Video aus der Reihe »Impulse zur Schul- und Unterrichtsentwicklung von und mit Jöran Muuß-Merholz. Hrsg: Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ). .
(2) Wittgenstein 1984, S. 519 und S. 520, zitiert aus: Andrea Anna Reichenberger (2011/2013): Wie wir Kippfiguren sehen können. In: The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB).
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
SchuleImFokus
Starke Schulen fördern Stärken
Zum Herunterladen steht Ihnen die ganze Rubrik SchuleImFokus mit allen Artikeln zur Verfügung.
K. Schneider: 'Es ist gut, wie es ist!' – Richtsbergschule Marburg
Lernen mit digitalen Hilfsmitteln – so sehen es Jugendliche der Richtsbergschule in Marburg
Ein Gespräch mit David, Wanja, Ida, Oskar und Johan
hier lesen
Konstanze Schneider im Gespräch
Mit dem nachfolgenden Interview wollen wir zum Thema unseres Magazins auch Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen lassen. Das Gespräch führte ich mit einer Gruppe von Jugendlichen aus dem Jahrgang 9/10 der Richtsbergschule in Marburg, einer integrierten Gesamtschule in Mittelhessen.
Einen ausführlichen Bericht und das Portrait der Richtsbergschule finden Sie im Magazin „Die Schule für alle“ 2020/1 auf S. 15ff.
Die Richtsbergschule hat seit 2019 ihr Lernkonzept verändert und arbeitet mit dem PerLenWerk (personalisierte Lernumgebung mit Werkstätten), jahrgangsübergreifend, mit individuellen Stundenplänen und Arbeitsplätzen für die Schülerinnen und Schüler. Sie ist gebundene Ganztagsschule und Kulturschule des Landes Hessen.(www.richtsbergschule.de) Die fünf Jugendlichen aus den Jahrgängen 9 und 10 lernen und arbeiten seit ihrem Start in der Richtsbergschule nach diesem Konzept
Sie besitzen alle ein Handy, das IPad für die Schule – das Pflicht ist und erworben werden muss – teilweise einen PC und nutzen die digitalen Möglichkeiten ihrer Familien, um zu spielen, Filme zu schauen und mit Freunden zu kommunizieren. Selbstkritisch schätzen sie ihre nicht-schulische Zeit an den digitalen Geräten auf 20–30 Stunden pro Woche. Drei der fünf jungen Leute lesen zurzeit ein Buch.
Eure Handys werden seit diesem Schuljahr morgens eingeschlossen. Wie ist das für euch?
Oskar: Ich finde das gar nicht schlimm. Vorher durften wir es auch nicht benutzen. Auf dem IPad kann man auch einiges machen.
Ida: Am Schultag brauche ich es nicht.
Wanja: In der Schule sind die Freunde, wenn ich alleine bin, brauche ich es mehr.
Wie ist euer Lernen in der Richtsbergschule organisiert und wie verwendet ihr das IPad?
Oskar: Jeder hat sein eigenes IPad und z. B. in Mathe haben wir eine App, da finden wir die Aufgaben, wir tippen sie ein. Rechnungen kann man entweder auf dem geteilten Bildschirm direkt machen oder auf einem Block wie früher.
Johan: Wir arbeiten meistens auf dem IPad und schicken, wenn wir alles bearbeitet haben, dem Lernbegleiter unsere Ergebnisse z.B. über Good Notes.
Wanja: Seit dem 10. Schuljahr schreiben wir zentrale Klassenarbeiten, meistens auf Papier. Vorher waren es Gelingensnachweise, die wir individuell angemeldet haben. Die waren auch auf Papier. Jetzt kann unsere Lehrerin z. B. in Mathe auf ihrem Bildschirm unsere Bildschirme sehen und nachverfolgen, wie wir arbeiten. Das geht digital.
Ida: Wir können uns auch aussuchen, ob wir auf dem IPad oder auf Papier schreiben. Meine Fremdsprachenlehrerin möchte, dass wir auch auf dem IPad nicht nur tippen, sondern auch mit dem Stift schreiben.
Wie seid ihr auf die andere Art des Arbeitens mit digitalen Medien vorbereitet worden?
Johan: Im 5. Schuljahr gab es eine Einführungswoche zum Umgang mit Medien. Da haben wir das Wichtigste gelernt. Man lernt es dann auch mit den anderen.
David: Ich kam erst später in die Richtsbergschule. Mir hat meine Lehrerin die wichtigsten Dinge gezeigt und erklärt und ich habe mir das nach und nach angeeignet. Es gibt auch genaue Vorgaben der Schule, wie die IPads gestaltet sein sollen und welche Apps erlaubt sind.
Welche Vorteile seht ihr bei der Gestaltung von Lernen, wie ihr sie hier erlebt?
Johan: Ich mache die Erfahrung, dass ich mich nicht so schnell ablenken lasse. Man lernt viel für die Medienkompetenz, wie man z. B. verschiedene Programme benutzt. Das braucht man später bestimmt im Beruf.
Oskar: Ich finde die Vielfältigkeit gut. Man hat auch Zugriff auf andere Lernprogramme und kann sich informieren. Außerdem kann man über den Chat mit den Lernbegleitern immer kommunizieren und bekommt Antwort und Hilfe. Früher hätte man sie anrufen müssen, was nicht alle wollen.
David: Für mich ist der große Vorteil beim digitalen Lernen, dass wir keine Bücher rumschleppen müssen, sondern alles auf dem IPad dabei haben. Das ist wirklich praktisch.
Ida: Da möchte ich direkt anschließen: Man verliert weniger Sachen. Wenn man seine Daten gut verwaltet, findet man alles wieder, auch durch die Cloud.
Wanja: Wenn man das IPad verliert oder vergisst, dann kann es blöd werden. Man kann dann an dem Tag schlecht mitarbeiten. Deshalb kommt das kaum vor. Das IPad gehört einfach dazu.
Seht ihr auch Nachteile?
Ida: Man kann sich sehr, sehr leicht ablenken lassen. Durch die ManagedAppleID ist es besser geworden. Aber man kann nebenbei ein YouTube-Video schauen oder etwas malen.
Wanja: Ich weiß noch, in der 5. Klasse konnte ich nicht damit umgehen, da konnte man sich noch Spiele runterladen.
David: Ich glaube es ist einfach ungesünder, den ganzen Tag auf den Bildschirm zu schauen. Das strengt die Augen an.
Johan: Je älter man wird und je ernster die Schule wird, desto weniger kann man es sich leisten, sich ablenken zu lassen. Ab der 8. Klasse ist das einfach so.
Ida: Ich finde, dass die Regelung mit den farbigen Ausweisen (siehe Konzept der IGS Richtsberg), die angeben, wo man sich aufhalten darf, hilft, konzentrierter zu arbeiten. Wenn ich meinen Arbeitsplatz frei wählen kann, das gefällt mir gut.
Eure Schule ist Ganztagsschule, wie sieht es mit der Lernzeit und Hausaufgaben aus?
David: In den Jahrgängen 5–8 gibt es Lernzeitaufgaben, die wir hier in der Schule machen.
Oskar: In der Zeit waren es nicht so viele Aufgaben, das war gut zu schaffen. Aber seit der 9. Klasse ist es sehr viel Stoff geworden. Dazu reicht die Lernzeit nicht aus. Deshalb finde ich, dass wir ab der 9 Klasse weniger Lernzeit, aber dafür mehr Unterricht haben sollten.
Johan: Es wird immer davon ausgegangen, dass wir alle super schlau sind, konzentriert durcharbeiten und 100 % der Zeit produktiv sind und das für alle Fächer, wenn man nicht so ist, dann ist der Inhalt einfach zu viel.
Ida: Unsere Woche ist ziemlich vollgeklatscht, wir haben 90 Minuten ‚Puffer’ im Stundenplan, aber das reicht nicht, um alles zu erledigen. In Klasse 5–8- war alles sehr entspannt, das ist jetzt anders.
Wanja: Es ist schon schwer, sich immer zu konzentrieren, mit den Freunden drum herum, das lenkt schon ab.
Oskar: Wir sind wirklich sehr durchgetaktet, vor allem, wenn Arbeiten geschrieben werden, die ja jetzt zentral stattfinden. Wenn man noch Bus fahren muss und auch im Sportverein aktiv ist, dann wird es abends oft spät.
Wie wird hier mit dem Thema künstliche Intelligenz umgegangen?
Johan: Es kommt auf den Lehrer an. Manche sind sehr streng und verbieten die Nutzung. Andere sind entspannt und sehen den Vorteil, dass wir lernen, KI zu nutzen und damit umzugehen.
Ida: Es ist doch so, dass wir bei den neuen IPads ChatGPT als App drauf haben?! Manche Lernbegleiter sind da total unentspannt, andere sagen, z. B. in Spanisch lass‘ mal KI deinen Text korrigieren. Aber da habe ich den Text ja selber geschrieben.
David: Genau, es kommt auf das Fach an: z. B. in Deutsch zum Thema Sachtexte kann KI meinen Text korrigieren und ich sehe meine Fehler. Aber in Mathe geht das nicht
Wanja: Ich nutze ChatGPT zur Recherche oder lasse mir helfen, wenn ich nicht weiter weiß oder lasse mir Lernvideos empfehlen. Natürlich kann man sich Hausaufgaben machen lassen, aber da muss man sich selber sagen, dass das nicht schlau ist. Denn es fehlt dann die Übung für die Lernkontrollen.
Welche Botschaft habt ihr an eure Lehrer und Lehrerinnen?
David: Ich finde, unsere Lehrer machen das ganz gut. Ich wüsste nicht, was sie verbessern sollten.
Wanja: Unsere Lehrer sind auch sehr fit mit den digitalen Geräten. Manchmal muss man ihnen bei Apple TV helfen oder sie fragen, wer kennt sich hier aus und wir unterstützen sie.
Johan: Schule sollte helfen, das zu unterstützen, was man gut kann. Es sollten alle zusammen lernen und es soll nicht immer nur um Leistung gehen.
David. Lehrer sollten Nächstenliebe zeigen und nicht zu streng sein. Die Lehrer waren doch auch alle mal Schüler, das sollten sie bedenken. Bei uns gibt es ein gutes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern, das ist gut so.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
L. Ritzka: Vernetzt lernen – Leonardo da Vinci Campus Nauen
Sport- und Kreativitätsgesamtschule des Leonardo da Vinci Campus in Nauen
Lernen ein Abenteuer – in offenen Lernlandschaften mit digitaler Lernumgebung
hier lesen
Linda Ritzka
„Wir lernen nicht nur mit Tablets – wir gestalten unsere Lernwelt selbst.“
Dieser Satz einer Zehntklässlerin bringt auf den Punkt, was an der Leonardo da Vinci Gesamtschule längst Realität ist: Digitalität ist hier kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag. Tablets, Lernplattformen und projektbasiertes Arbeiten verbinden Unterricht, Partizipation und digitale Kompetenzen – mit messbaren Lernerfolgen und praxisnahen Lernsettings.
Digitalität wird heute nicht mehr ausschließlich als Fortschrittsversprechen gefeiert, sondern zunehmend kritisch – gerade im Bildungsbereich – diskutiert. Nach Jahren intensiver Bemühungen, Schulen umfassend zu digitalisieren, ziehen sich inzwischen erste Länder wieder spürbar zurück. Umso dringlicher stellt sich die Frage: Wie lassen sich digitale Technologien sinnvoll und nachhaltig in den Schulalltag einbinden – über die bloße digitale Kopie von Schulbüchern hinaus? Wie entfaltet der Computer sein pädagogisches Potenzial als Lern- und Arbeitswerkzeug?
Ein Campus, ein Leitbild
Unsere Gesamtschule ist Teil eines lebendigen Campus, der Bildung und Betreuung von der Kita bis zum Abitur vernetzt. Wohngruppen, Hort und Ganztagsangebote schaffen einen durchgängigen Bildungs- und Lebensraum, in dem Kinder und Jugendliche nicht nur fachlich gefördert, sondern auch sozial gestärkt werden. Dieses Campusmodell prägt unser Leitbild: Lernen und Leben gehören zusammen – verlässlich, inklusiv und zukunftsorientiert.
Rund 420 Schüler:innen lernen derzeit in der Mittel- und Oberstufe der Gesamtschule – in kleinen, gut betreuten Tutorien. Schon in der Mittelstufe können sie eigene Schwerpunkte setzen: kreative Profile wie Kunst oder Musik, Sport oder MINT. Zusätzliche Ganztagsstunden bieten Raum, Talente zu entfalten und eigene Interessen zu vertiefen. Kunstausstellungen, Konzertabende und sportliche Erfolge sind sichtbarer Ausdruck einer lebendigen Schulkultur.
Unsere Vision – erste Schritte
Unser Unterricht nutzt digitale Werkzeuge nicht als Selbstzweck, sondern als Chance, individuelle Lernwege zu eröffnen, Zusammenarbeit zu stärken und junge Menschen zu kritisch denkenden Gestalter:innen einer vernetzten Zukunft zu befähigen.
2016 starteten wir den Weg in die Digitalität: Lehrkräfte erhielten dienstliche Laptops, Schüler:innen brachten eigene Geräte mit. OneNote ersetzte Hefte und Bücher, „Teams“ wurde zur Kommunikationsplattform. Von Beginn an verabschiedeten wir uns von vorgefertigten Materialien der Schulbuchverlage und entwickelten passgenaue Inhalte für unsere heterogenen Lerngruppen. Projektorientiertes Arbeiten wurde früh zum Markenzeichen unseres Schulkonzepts.
Dann kam die Corona-Pandemie. Während vielerorts Stillstand herrschte, blieben wir handlungsfähig: Kinderzimmer und Küchen wurden zu Klassenräumen, gemeinsames Lernen und Prüfen fand nahtlos über Bildschirme statt. Die etablierten digitalen Strukturen trugen – der Bruch fiel vergleichsweise gering aus.
Neue Wege: Lernen neu gedacht
Doch wir wollten mehr: 2023 wagten wir den nächsten großen Schritt und brachen Mauern ein, im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Wer Lernen neu denkt, muss auch die äußeren Rahmenbedingungen verändern.
Klassische Klassenräume wichen offenen Lernlandschaften mit Gruppentischen, Lernnischen und Ruheräumen. Starre 45-Minuten-Takte wurden abgelöst von großzügigen Freiarbeitsphasen, flexiblen Kurswahlen und individuellen Lernplänen, die auf unterschiedliche Leistungsniveaus eingehen.
Die Fächer sind heute kompetenzorientiert modularisiert und um projektbasierte Alternativen ergänzt. Zu Beginn des Schuljahres erhalten die Schüler:innen eine Übersicht mit allen Modulen, Gelingensnachweisen und Prüfungsformaten. In wöchentlichen Einzelgesprächen planen sie gemeinsam mit ihrer Tutorin oder ihrem Tutor, welche Materialien sie bearbeiten und wann sie Prüfungen ablegen.
Unsere digitale Lernumgebung bildet dafür den organisatorischen Kern: Sie bündelt Kurspläne, Materialien und Lernfortschritte. Ein Graduierungsmodell (Level A–E) zeigt den aktuellen Stand der Eigenständigkeit und steuert, wie eng die Tutor:innen begleiten.
Zu Schuljahresbeginn buchen die Schüler:innen über die Plattform ihre Nebenfächer – aus Gesellschafts- und Naturwissenschaften sowie den Kreativbereichen – und wählen selbst, bei welchen Lehrkräften und in welchen Lerngruppen sie arbeiten möchten. In den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik übernehmen sie ebenfalls Verantwortung: Viermal im Jahr wählen sie ihre Kurse neu. Ein Teil der Unterrichtszeit fließt in diese Kurse, der Rest des Stundenkontingents in pädagogisch begleitete Freiarbeit: Das wären beispielsweise bei Deutsch oder Englisch je 1 Stunde Lektüre-/Kommunikationskurs die Woche und 3–4 h Freiarbeit; bei Physik oder Chemie wären es je 1 h Experimentierkurs und Freiarbeit.
Gelernt wird auf dem sogenannten „Marktplatz“: einer offenen Fläche mit fachspezifisch gestalteten Zonen – Deutsch mit kleiner Bibliothek, Mathematik mit Lernkästen zur Visualisierung theoretischer Konzepte, Englisch mit Lektüren und Lernhilfen. Jede Zone wird von Fachlehrkräften begleitet, die individuell unterstützen und Impulse geben. Das digitale Material ist auf den Endgeräten der Lernenden stets verfügbar – jederzeit und überall.
Auch die Leistungserbringung passt sich unserem digitalen und heterogenen Lernkonzept an. Einen wachsenden Anteil bilden prozessbegleitende und kooperative Leistungen, die den unterschiedlichen Lernwegen gerecht werden: Leistungen zeigen sich in authentischen Formaten – von Portfolios, digitalen Zeitungsartikeln und Forschungsprotokollen bis zu multimedialen Präsentationen oder digital gestützten Fachgesprächen. Neue Prüfungsformate machen Lernstände transparent und ermöglichen eine differenzierte, flexible Bewertung, die individuelle Stärken sichtbar werden lässt. So wird deutlich: Digitalität eröffnet Räume, in denen Heterogenität nicht als Herausforderung, sondern als Chance für vielfältige, passgenaue Leistung sichtbar wird.
Ohne diese digitale Lernumgebung wäre ein so hohes Maß an eigenständigem und verantwortungsvollen Lernen kaum denkbar. Erst sie ermöglicht , dass Schüler:innen ihre Kurse selbst wählen, nach Leistung und Interesse differenziert arbeiten und ihren Lernweg individuell gestalten können. Unser adaptives Unterrichtskonzept gewinnt durch digitale Werkzeuge entscheidend an Flexibilität – und macht personalisiertes Lernen im Alltag überhaupt umsetzbar.
Erfahrungen, Chancen, Perspektiven
Der Weg war nicht immer einfach. Manche Schüler:innen fühlten sich von der neuen Eigenverantwortung zunächst überfordert, manche Eltern fürchteten, ihre Kinder könnten beim Lernen allein gelassen werden, und auch Lehrkräfte hinterfragten den zusätzlichen Aufwand. Doch wir nahmen diese Bedenken ernst, schufen Räume für Austausch und Beteiligung und überzeugten die meisten, den Weg mit uns zu gehen.
Heute gestalten die Kolleg:innen den Unterricht dank digitaler Möglichkeiten interaktiver, inklusiver und individueller. Zugleich haben wir gelernt, dass nicht jede Lernphase von Digitalität profitiert: Wenn die 37. PowerPoint-Präsentation im Schuljahr abgespeichert wird oder Arbeitsblätter nur noch als PDFs erscheinen, verpufft der Mehrwert. Entscheidend ist der sinnvolle Einsatz – Qualität vor reiner Quantität.
Unsere nächsten Entwicklungsschritte liegen in der weiteren Ausweitung projektbasierter Lernformate und darin, auch die Oberstufe vollständig in das adaptive Lernkonzept einzubeziehen. Die ersten Jahrgänge, die ausschließlich mit dem neuen Modell aufgewachsen sind, erreichen nun die Sekundarstufe II und erwarten konsequente Weiterentwicklung.
Blick nach vorn
Digitale Medien sind für uns kein Trend, sondern ein Schlüssel, um die Zukunftskompetenzen von Schüler:innen und Lehrkräften zu stärken: kritisches Denken, Kreativität, Teamfähigkeit und die Fähigkeit, sich in einer vernetzten Welt sicher zu bewegen.
Dabei muss niemand ein „Digital-Nerd“ sein. Entscheidend ist der Mut, Neues auszuprobieren, Lücken zu akzeptieren und aus Erfahrungen zu lernen. Digitalität in der Schule ist kein fertiges Produkt, sondern ein lebendiger Prozess. Wir evaluieren, justieren und entwickeln uns weiter. So bleibt Lernen ein offenes Abenteuer – für unsere Schüler:innen ebenso wie für uns als Lehrkräfte.
Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4
R. Hahn: Erfahrungen mit KI in einer Schule mit schwierigem Umfeld – Grund- und Gemeinschaftsschule am Brook Kiel
Die Grund- und Gemeinschaftsschule am Brook in Kiel-Gaarden
KI – eine echte Chance für neue Formen des Lernens und zur Überwindung von Sprachbarrieren
hier lesen
Roy Hahn
Die Gemeinschaftsschule selbst wurde im Schuljahr 2010/2011 gegründet, als die damalige Haupt- und Förderschule am Standort Brook – das ist ein kleiner Wasserlauf – zu einer der ersten Gemeinschaftsschulen in Kiel umgewandelt wurde. Sie ist eine offene Ganztagsschule und bietet den Ersten allgemeinbildenden und den Mittleren Schulabschluss an sowie eine „Clever-Kooperation“ mit den regionalen Berufsbildungszentren (Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife).
Nach der Zusammenlegung mit der Grundschule, deren Fusion in diesen Wochen stattfindet, hat die Gemeinschaftsschule aktuell 36 Klassen, inkl. DaZ, und insgesamt 760 Schülerinnen und Schüler.
An der Gemeinschaftsschule am Brook in Kiel-Gaarden nutzen wir KI im Unterricht zur Überwindung von Sprachbarrieren, zur Vertiefung des Textverständnisses und zur Förderung von Diskussionen. Damit verbunden sind mehr Teilhabe, Zeitgewinn und neue Formen des Lernens – immer auch mit Fokus auf die kritische Nutzung von KI.
Als wir an der Gemeinschaftsschule am Brook in Kiel-Gaarden vor gut einem Jahr den offiziellen Zugang zu ChatGPT über die landeseigene Plattform OPSH bekamen, war ich neugierig und höchst motiviert. Kiel-Gaarden ist ein Ausnahmestadtteil – bunt, lebendig, aber auch von sozialen Herausforderungen geprägt, wie man sie in Schleswig-Holstein selten findet. Unsere Schule ist Teil des Startchancen-Programms (früher in Schleswig-Holstein bekannt als Perspektiv Schulen) und wir stehen täglich vor besonderen Aufgaben: Viele Schülerinnen und Schüler wachsen mehrsprachig auf, viele Familien leben in schwierigen sozialen Verhältnissen und die sprachlichen Hürden im Unterricht sind hoch. Für den Unterricht bedeutet das: Oft liegt das eigentliche Problem nicht im fehlenden Fachwissen. Ich erlebe Jugendliche, die komplexe Zusammenhänge verstanden haben, diese aber nicht ausdrücken können. Genau an dieser Stelle hat die Arbeit mit KI in den letzten Monaten einen Unterschied gemacht.
KI im Literaturunterricht
Besonders deutlich wurde mir das bei der gemeinsamen Lektüre eines Jugendbuchs – „Der aus den Docks“ - im vergangenen Halbjahr im Jahrgang 8. Wir hatten uns im Jahrgang auf ein Werk geeinigt, das sprachlich durchaus anspruchsvoll ist. Für einige Schülerinnen und Schüler war das zunächst eine große Hürde. Ich konnte ihnen die Fremdwörter erklären und wichtige Passagen paraphrasieren, aber das reichte nicht immer aus, damit sie wirklich ins Gespräch über den Text kamen.
Hier setzten wir den Chatbot ein. Gemeinsam mit den Jugendlichen ließen wir uns einzelne Absätze in eine einfachere Sprache übertragen. Manche baten sogar darum, schwierige Stellen in ihre Muttersprache zu übersetzen, um sicherzugehen, dass sie den Inhalt richtig verstanden hatten. Andere stellten dem Chatbot gezielte Fragen: „Warum verhält sich die Figur so?“ oder „Was bedeutet dieser Ausdruck in der Situation?“ Aus diesen Nachfragen entstand plötzlich eine lebendige Diskussion. Die Jugendlichen begannen, sich über die Handlung auszutauschen, ihre Meinungen zu vergleichen und Argumente zu entwickeln. Das wäre ohne die Unterstützung kaum in dieser Intensität möglich gewesen.
Ein Beispiel ist mir dabei besonders wichtig: Ich hatte Teile des Buches in den ChatBot eingespeist, sodass die Schülerinnen und Schüler ihre Fragen in ihrer eigenen Sprache stellen konnten – egal ob auf Türkisch, Bulgarisch oder Arabisch. Für mich allein wäre das schlicht unmöglich gewesen. Natürlich ersetzt das nicht die Notwendigkeit, Deutsch zu lernen. Aber Deutschunterricht ist viel mehr als nur Grammatik und Rechtschreibung. Es geht auch um die Auseinandersetzung mit Kulturgütern und um die Frage, wie man Motivation fürs Lesen weckt. Ist die Grundvoraussetzung des Verstehens nicht gegeben, ist das Begeistern für die Sprache an sich nahezu unmöglich. Genau hier hat mir die KI wertvolle Unterstützung geleistet.
KI im Physikunterricht
Ein zweites Erlebnis hatte ich in meinem Physikunterricht, ebenfalls im 8. Jahrgang. Es ging um Elektrizitätslehre. Normalerweise ist das Beschäftigen mit Physikgeschichte ein eher mühsames Unterfangen. Mit ChatGPT konnte ich jedoch Bots erstellen, die sich als historische Physiker ausgegeben haben. Die Schülerinnen und Schüler haben Interviews mit diesen „Physikern“ geführt und anschließend Präsentationen erstellt, die ich bewertet habe. Die Kinder hatten Spaß dabei, und gleichzeitig wurden Aspekte der Medienbildung ganz nebenbei interdisziplinär mitgefördert. Für viele war das ein völlig neuer Zugang zu einem Fach, das sie sonst oft nur über Formeln und Experimente wahrnehmen.
Solche Erfahrungen zeigen mir, welches Potenzial in der Nutzung von KI liegt. Es geht nicht darum, den Schülerinnen und Schülern die Arbeit abzunehmen oder ihnen fertige Lösungen zu liefern. Vielmehr geht es darum, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre eigenen Fähigkeiten besser entfalten können. Wo früher Sprachbarrieren eine Mauer bildeten, können wir sie nun zumindest teilweise einreißen.
Natürlich profitiere auch ich als Lehrkraft. Arbeitsblätter, Wortlisten oder differenzierte Aufgabenstellungen kann ich mir mit Unterstützung der KI schneller erstellen lassen. Vor allem aber schafft es Zeit. Und Zeit ist in der Bildung eine Ressource, die stets knapp ist. Mit etwas mehr Zeit kann eine Lehrkraft dem eigentlichen Kerngeschäft besser nachgehen: der persönlichen Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern. Ich habe außerdem erlebt, dass nahezu das gesamte Kollegium offen für die neue Technologie ist. Während einige sie nur gelegentlich nutzen, um Aufgabentypen zu variieren oder Beispielsätze zu erzeugen, setzen andere die KI bereits viel umfassender ein. Genau darin liegt die Stärke dieser Werkzeuge: Sie lassen sich so nutzen, wie es zum eigenen Unterrichtsstil passt.
KI-Antworten überprüfen
Es wäre allerdings nicht richtig zu behaupten, dass alle Schülerinnen und Schüler stets hervorragende Ergebnisse erzielt haben. In einer Einheit waren die Ergebnisse unzureichend, weil sich einige zu sehr auf die Antworten der KI verlassen hatten, ohne sie kritisch zu prüfen. Genau diese Erfahrung hat bei vielen die Augen geöffnet. Seitdem ist das Überprüfen und Faktenchecken von KI-Antworten für die Schülerinnen und Schüler zunehmend zur Selbstverständlichkeit geworden. ChatGPT ist nämlich bei Weitem nicht unfehlbar. Manchmal sind die Antworten ungenau, manchmal schlicht falsch. Und immer schwingt die Gefahr mit, dass Schülerinnen und Schüler Ergebnisse ungeprüft übernehmen. Deshalb ist es für mich zentral, mit ihnen darüber zu sprechen, wie die KI funktioniert, wo ihre Grenzen liegen und warum man niemals alles für bare Münze nehmen darf.
Einer Tatsache müssen wir jedoch alle in die Augen blicken: KI wird von den Jugendlichen ohnehin genutzt – ob wir wollen oder nicht. Wenn wir das Thema im Unterricht ausklammern, überlassen wir sie ihren eigenen Erfahrungen, ohne Orientierung oder Korrektur. Das halte ich für gefährlich. Schule muss ein geschützter Raum sein, in dem ausprobiert werden darf, in dem Fehler passieren dürfen und in dem man über Stärken und Schwächen einer Technologie spricht. Natürlich bleibt die Arbeit mit KI ein Balanceakt. Sie darf nicht zum Ersatz für eigenes Denken werden, sondern soll es unterstützen. Sie darf nicht zur Quelle ungeprüfter Informationen verkommen, sondern muss Anlass sein, kritisch zu hinterfragen. Diese Balance herzustellen, sehe ich als eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Dieses Jahr probieren wir das erste Mal bei uns an der Schule aus, KI explizit bei den Abschlussprüfungen zuzulassen. Die erste Phase davon ist bereits angelaufen (Themen- und Gruppenfindung). Dabei wurde KI bereits genutzt, um Ideen zu suchen. Aus meiner Sicht sind da teilweise sehr spannende Ansätze rumgekommen, auch eine Gruppe, die sich explizit den Einfluss von KI auf die Psyche anschaut – spannend.
Fazit
Nach einem Jahr mit ChatGPT an unserer Schule ziehe ich für mich eine positive Bilanz. Ich habe gesehen, wie Schülerinnen und Schüler, die sich sonst im Unterricht kaum äußern, mit neuer Sicherheit in den Diskurs treten konnten. Ich habe erlebt, wie sich Diskussionen vertieft haben, weil plötzlich alle dieselbe sprachliche Grundlage hatten. Und ich habe gelernt, wie wertvoll es ist, den Einsatz von KI nicht dem Zufall zu überlassen, sondern ihn bewusst in den Unterricht zu integrieren. Für mich als Lehrkraft ist es ein gutes Gefühl, meine Schülerinnen und Schüler auf eine Zukunft vorzubereiten, in der der Umgang mit Künstlicher Intelligenz selbstverständlich sein wird – aber hoffentlich auch kritisch und reflektiert.
Für unsere Schule im Brennpunkt bedeutet die Arbeit mit KI eine echte Chance. Eine ehrliche Prognose, wie sich KI auf das Schulleben auswirkt, kann aus meiner Sicht noch nicht erstellt werden, da das Thema noch zu jung ist. Die aktuellen Beobachtungen lassen aber die These zu, dass ein bisschen mehr Bildungsgerechtigkeit hergestellt wird. Ob das nachher auch zu tatsächlich besseren Abschlüssen führt, muss sich jedoch noch zeigen.
B. Riekmann, M. Pallesche: Uns geht es um Ergebnisoffenheit und Sinnhaftigkeit – Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule Karlsruhe
Ein Gespräch mit Micha Pallesche, Schulleiter der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe
Eine Medienschule von Anfang an – der Prozess ist wichtig, das Produkt steht im Zentrum
hier lesen
Barbara Riekmann, Micha Pallesche
Die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule hat in den vergangenen Jahren ihre Lernkultur grundsätzlich verändert. Im Zentrum stehen die individuelle Arbeit an Wochenplänen und Lernweglisten, das themenorientierte Arbeiten als fächerübergreifender Unterrichtsansatz, ein erweitertes Bildungsangebot im Rahmen einer gebundenen Ganztagsschule sowie ein kontinuierliches Lerncoaching. Als Medienschule von Anfang an ist die Schule mehrfach ausgezeichnet worden. In diesem Jahr hat sie den Deutschen Schulpreis im Themenkreis Demokratiebildung erhalten.
In Ihren Veröffentlichungen betonen Sie, dass die digitale Kultur und die Bausteine einer neuen Lernkultur in der Entwicklung Ihrer Schule eng miteinander zusammenhängen. Hat die Digitalität Ihre Schule verändert oder war es umgekehrt?
Wir haben uns ab 2014 intensiv mit dem Gedanken befasst, Schule anders zu denken. Damals war klar, dass wir an unserer Lernkultur arbeiten wollen. Das war der Ausgangspunkt. Aber die Tatsache, dass digitale Medien eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft spielen, wollten wir in unser Profil aufnehmen, und zwar zunächst mal, um die Lernprozesse zu unterstützen. Uns wurde aber relativ schnell klar, dass es um mehr geht, nämlich um ein grundlegend anderes Verständnis. Digitale Geräte eben nicht mehr nur als Tools zu sehen, mit denen analoge Prozesse optimiert werden. Sondern dass es um veränderte kulturelle Praktiken geht, die unsere Gesellschaft verändern und sich natürlich auch in irgendeiner Form im Lernen der Kinder widerspiegeln müssen. Wenn man sich diese Praktiken einer Kultur der Digitalität anschaut, findet sich etwas wie Partizipation, dann geht es um Co-Creation. Gerade in einer Welt, die immer komplexer wird, muss man gemeinschaftlich co-creativ Probleme lösen. Es geht um Ergebnisoffenheit, und es geht auch um Sinnhaftigkeit. Wenn man das berücksichtigt, sind digitale Medien ein Bestandteil des Lernens, aber sie sind kein Add-On mehr, sondern sie sind ganz organisch eingebunden in den Lernprozess.
Wir haben relativ früh damit begonnen, digitale Medien zu nutzen, um Produkte zu schaffen; es ging uns darum, dass Lernende ihre eigenen Materialien, ihren eigenen Content selbst produzieren. Das war damals unser Einstieg, der sehr spannend war, denn letztendlich ging es um die veränderte Praxis.
Welche Beispiele für diese Arbeitsweise würden Sie besonders hervorheben, worauf sind Sie besonders stolz?
Im gesamten Bereich der Produktion sind unsere Schüler:innen unglaublich stark, also im Erstellen von Materialien, von Erklärvideos, von Podcasts, von Audiodateien. Wir legen zugleich großen Wert auf den Bereich des Jugend-Medienschutzes. Auch da sind die Schüler:innen gut aufgeklärt und kritisch. Wir haben eine tolle Schüler:innenzeitung, das „Ernschtle“, sie ist ganz aktuell auch die beste Deutsche Schüler:innenzeitung, die crossmedial arbeitet. Sie erscheint einmal im Jahr als Printmedium, aber auch als Internetseite –ernschtle.de–. Es gibt einen Videokanal, aktuell wird dort ein Podcast erstellt.
Bei den Lernsettings gibt es den einen Bereich, in dem Schüler:innen individualisiert arbeiten, ihre eigenen Lernpfade verfolgen und durch Programme unterstützt werden. Ein zweiter Bereich ist uns sehr wichtig: Wir haben vor fünf Jahren das sogenannte „Themenorientierte Arbeiten“ eingeführt – THEA – bei dem wir Themenfelder aus den 17 Nachhaltigkeitszielen identifiziert haben, um diesen dann die Inhalte der Bildungspläne aus dem Fächerkanon der Nebenfächer zuzuordnen. So entstanden vier Themenfelder in den Klassen 5, 6 und 7. Wir arbeiten en bloc und beleuchten das Themenfeld aus unterschiedlichen Fachperspektiven. Am Ende steht immer ein Produkt. Zum Beispiel haben wir ein Themenfeld, das nennt sich „Das grüne Wunder Wald“; da sind wir 10 Wochen lang im Wald mit dem Forstamt als Kooperationspartner. Die Schüler:innen dokumentieren mit Portfolios, was sie dort wöchentlich machen, und dann entsteht ein Produkt, also entweder ein Erklärvideo, das produziert wird oder ein Modell, das gebaut wird oder ein Marktstand beim Karlsruher Stadtfest, um dort Honig zu verkaufen. Diese Lernnachweise entstehen aus einer guten Kombi aus analogen und digitalen Mitteln.
Welche Ausstattung war hierfür notwendig?
Alle Klassen- und Lerngruppenräume haben Präsentationsmöglichkeiten. Wir arbeiten mit schuleigenen Tablets in Tablet-Koffern. Dabei haben wir bewusst keine Eins-zu-Eins-Versorgung, weil wir die Geräte nur nutzen wollen, wenn wir sie brauchen. Für das mobile Lernen ist wichtig, dass die digitale Ausstattung im ganzen Hause und auch außerhalb auf dem ganzen Schulgelände vorhanden ist. Zentral für uns ist der Maker-Space-Raum. Das ist im Grunde ein Filmproduktionsstudio mit Schnittplätzen, Robotik, Coding, 3-D-Drucker, Mikrocontroller usw. Ich glaube, da sind wir sehr privilegiert. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir früh dran waren. Wir sind 2014/15 mit dem Medienprofil gestartet, 2017 waren wir die erste Smart-School Baden-Württembergs - früh dran also auch im Kontakt mit dem Schulträger und haben zudem über Preisgelder und Stiftungen Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen.
Auf unserer digitalen Lernplattform arbeiten wir mit DiLer, die von einem Team der Gemeinschaftsschule Wutöschingen entwickelt wurde. Auf der sogenannten Next Cloud, einer datenschutzrechtlich abgesicherten Cloud-Lösung auf unserem Server, können die Schüler:innen Daten ablegen, tauschen und damit auch kollaborativ arbeiten.
In Ihrem Schulprofil betonen Sie „Ein Minimum an individuellen und ein Optimum an kooperativen Lernen“. Wie halten Sie diese Balance?
Der Zeitgeist geht aktuell in Richtung Individualisierung. Dies auch, weil neue technische Möglichkeiten vorhanden sind und die künstliche Intelligenz darin ihre Stärken hat, beispielsweise in der Diagnostik und danach natürlich im adaptiven Lernen. KI kann individuelle Lernpfade erstellen, sie kann reagieren, sie kann Feedback geben. Ich sehe darin eine Gefahr, denn es wird außer Acht gelassen, dass die Fragestellungen, die Schülerinnen und Schüler in Zukunft erwartet, so komplex sind, dass sie eben nicht mehr individuell gelöst werden können. Was wir bräuchten, wären reale Problemstellungen, komplexe Fragestellungen, die von Schülerinnen und Schülern möglichst gemeinschaftlich co-creativ gelöst werden. Das wäre jetzt mein Weg mit meiner Schule.
Einen Gedanken würde ich gerne zusätzlich in die Diskussion einbringen. Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich Lehrkräfte an so genannten Best Practice Schulen gefragt, was für sie Transformation bedeutet. Für die Lehrkräfte war das „Entgrenzen“ von Fach-, Zeit- und Ortsstrukturen das wichtigste Element der Transformation. Wenn man das betrachtet, müssen wir alles nochmal auf den Kopf stellen und aus der Schülerperspektive fragen, wie gutes Lernen eigentlich aussehen muss.
Noch einmal zur KI. Wie gehen Sie damit um?
Wir haben direkt nach dem Erscheinen von ChatGPT vor zweieinhalb Jahren mit der gesamten Schulgemeinschaft einen „Roten Salon“ zu dem Thema gemacht und sind der Frage nachgegangen, was es für das Lernen und auch für uns bedeutet. Wir haben dann neue Formate entwickelt. Beispielsweise haben wir im Kunstunterricht Bilder zur Stadt der Zukunft digital und analog erstellt und miteinander verglichen. Oder wir haben die Projektprüfung umgestellt und erlaubt, dass für den Teil der Verschriftlichung KI benutzt wird - unter der Voraussetzung, dass die PROMs dargestellt und reflektiert werden. Unser Konrektor hat gerade selber einen Chatbot gebaut (Name: FlowERS), der empathisch ist, der ein Coach ist, der Schülerinnen und Schüler begleiten soll. Den Bot nimmt er mit in den Ethikunterricht, um zu diskutieren, ob eine KI überhaupt so etwas wie ein Coach oder eine Begleitung sein kann. KI wird sicherlich die Welt noch mehr verändern als das bisherige Technologien getan haben, aber sie ist nur eine weitere Technologie, sie wird nicht die letzte sein. Was wichtig ist, ist, dass wir Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, die Technologie und die ihr zu Grunde liegenden Algorithmen zu verstehen.
Welches sind Ihre nächsten Schritte?
Wir wollen die Schule noch weiter öffnen, das themenorientierte Arbeiten noch weiter entwickeln und die Arbeit an der Demokratiebildung weiter intensivieren. Demokratie muss im aktuellen Mitgestalten und im aktiven Tun in der unmittelbaren Umgebung erfahrbar und spürbar sein. Erst dann kann man ins Große, in die theoretischen Gedanken gehen. Aber die Kinder müssen es erlebt haben, um es zu verstehen.
Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch.
S. Lührs: KI gemeinsam starten – Digitale Unterrichtsentwicklung – Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen
an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen
Das Kollegium mitnehmen – schulinterne Fortbildung als Motor für Schulentwicklung
hier lesen
Susanne Lührs
„KI an Bord, du am Steuer“ – mit diesem Leitspruch hat eine Arbeitsgruppe der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule ihre Haltung zur Künstlichen Intelligenz auf den Punkt gebracht. Denn klar ist: Digitale Technologien und KI verändern den Bildungsalltag – tiefgreifend, schnell, mit offenen Fragen und großen Potenzialen. Für eine Schule wie unsere, in der das gemeinsame Lernen in heterogenen Gruppen im Mittelpunkt steht, ist das Chance und Herausforderung zugleich.
Wie kann Lernen mit digitalen Mitteln so gestaltet werden, dass niemand abgehängt wird? Wie gelingt es, KI-Kompetenzen nicht nur zu fordern, sondern tatsächlich zu fördern – bei Lehrkräften, Schüler:innen und Eltern? Und wie bewahren wir dabei das soziale, kooperative Lernen als Herzstück unserer Schulkultur?
Schon früh wurde seitens des Kollegiums und der AG „Digitales“ damit begonnen, eine Diskussion darüber anzustoßen, wie wir als Schulgemeinschaft mit KI umgehen wollen – und was wir brauchen, um souverän, kreativ und pädagogisch reflektiert damit zu arbeiten. Herausgekommen ist eine fünfteilige Fortbildungsreihe, in der sich unsere Lehrkräfte intensiv mit unterschiedlichen Aspekten von KI im Schulalltag auseinandergesetzt haben. Der Artikel gibt einen Einblick in dieses Format, unsere Erfahrungen damit und wie daraus ein gemeinsamer Lern- und Entwicklungsprozess entstanden ist – getragen von dem Anspruch, Bildungsgerechtigkeit auch im digitalen Zeitalter aktiv voranzubringen.
Unsere Fortbildungen wurden von Kolleg:innen aus dem eigenen Haus entwickelt und durchgeführt – nicht mit externen Referent:innen. Dadurch konnten die Themen gezielt auf unsere schulischen Fragen und Herausforderungen zugeschnitten werden. Gleichzeitig entstand durch die gemeinsame Arbeit ein Raum, in dem Kolleg:innen sich offen, praxisnah und mit gegenseitiger Unterstützung dem Thema KI nähern konnten.
Die Reihe umfasste fünf aufeinander aufbauende Termine, die jeweils verschiedene Perspektiven auf den Einsatz von KI im Schulalltag eröffneten – von den Grundlagen bis hin zu ethischen Fragen und Zukunftsvisionen. Im Mittelpunkt stand dabei immer das Prinzip: Input, ausprobieren, reflektieren, ins Gespräch kommen. Durch den zeitlichen Aufbau war es den Teilnehmenden möglich, zwischen den Terminen Neues auszuprobieren und Erfahrungen mit in den Folgetermin zu bringen.
Gleich zu Beginn stand das eigene alltägliche Handeln im Vordergrund. Unter dem Titel „Lasst uns loslegen“ ging es um die Frage, wie eine KI funktioniert, wie man Prompts optimieren kann und wie KI ganz konkret zur Unterstützung im schulischen Alltag genutzt werden kann, etwa bei der Differenzierung von Aufgaben, der Anpassung von Elternbriefen oder zur Strukturierung von Arbeitsmaterialien. Für viele war das eine erste Gelegenheit, KI-Tools in einem geschützten Rahmen kennenzulernen und einfach auszuprobieren. Denn die Fortbildungsreihe adressierte eben nicht nur diejenigen mit KI-Erfahrung, sondern auch absolute Neulinge. Zu diesem Zweck gab es bei einigen Terminen Gruppenangebote für erprobte „KI-Piloten“ sowie „KI-Entdecker:innen“ und auch eine „Starthilfe“-Gruppe, in der nochmal Fragen zu den Grundlagen gestellt werden konnten. Diese Differenzierung ermöglichte auch in einer thematisch heterogenen Gruppe einen guten Dialog, so dass trotz der Freiwilligkeit eine hohe Konstanz in der Teilnahme zu verzeichnen war.
In den weiteren Veranstaltungen wurde das Thema systematisch erweitert. So rückte etwa die Frage in den Fokus, wie KI auch im Klassenraum eingesetzt werden kann – nicht nur von Lehrkräften, sondern auch von Schüler:innen. Dabei ging es sowohl um technische Voraussetzungen als auch um didaktische Möglichkeiten: Welche Aufgabenformate eignen sich? Wo kann KI das Lernen tatsächlich bereichern? Es rückte aber auch die Frage in den Mittelpunkt, welche Kompetenzen Schüler:innen im Umgang mit KI eigentlich brauchen. Als Ausgangspunkt diente ein Kompetenzmodell (1), das vier zentrale Bereiche unterscheidet: Verstehen, Anwenden, Mitgestalten und Reflektieren. Vor allem im Bereich des Reflektierens wurde diskutiert und schließlich vereinbart, dass jeder KI-Output gemeinsam mit oder durch die Schüler:innen reflektiert werden muss.
Großes Interesse entwickelten die Teilnehmenden der Fortbildungsreihe als das Thema Chatbots aufkam. Die Vorstellung, eigene Bots zu gestalten, individuell an Unterrichtssituationen angepasst, hat nicht nur Neugier geweckt, sondern auch ganz praktische Ideen hervorgebracht – etwa für den Einsatz in Projektphasen, zur Unterstützung von Sprachlernprozessen oder zur Berufsorientierung. Gleichzeitig wurde deutlich, wie wichtig es ist, bei aller Begeisterung den pädagogischen Mehrwert im Blick zu behalten: Wann hilft der Einsatz von KI wirklich weiter – und wann steht er dem kooperativen Lernen im Weg? Wollen wir uns dafür entscheiden, individuelle Lernprozesse durch KI-Bots gestalten zu lassen oder verstehen wir Lernen als soziale Interaktion?
Diese Fragen gewannen noch mehr an Gewicht im Rahmen des vierten Termins, der sich mit rechtlichen und ethischen Aspekten befasste. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Rolle von KI in Rückmeldeprozessen – insbesondere im Kontext von Lernentwicklungsberichten, die an unserer Schule eine zentrale Funktion für individuelle Förderung und persönliche Beziehungsgestaltung haben. Die Diskussion zeigte deutlich: Der Wunsch nach Effizienz darf nicht auf Kosten von Empathie und pädagogischer Sorgfalt gehen. Gerade an dieser Stelle wurde im Kollegium spürbar, wie notwendig ein gemeinsames Werteverständnis im Umgang mit KI ist.
Den Abschluss der Reihe bildete eine Zukunftswerkstatt: Gemeinsam entwarfen die Teilnehmenden Visionen für das Lernen mit KI in fünf Jahren. Welche Rolle wird die KI spielen? Welche Aufgaben werden bei den Lehrkräften bleiben – und welche vielleicht nicht? Was brauchen Schüler:innen, um in einer digitalisierten Welt gut lernen zu können?
Diese Visionen bilden nun die Grundlage für den nächsten Schritt: In einem schulweiten Beteiligungsprozess entsteht in den nächsten Monaten ein gemeinsamer Orientierungsrahmen zum verantwortungsvollen Umgang mit KI. Ziel ist es, grundlegende Prinzipien festzuhalten – etwa Transparenz, Augenmaß und Verantwortung – und diese mit Lehrkräften, Schüler:innen und Eltern abzustimmen. Erste Entwürfe werden an einem SchiLf-Tag von den Jahrgangsteams und der Schüler:innenvertretung diskutiert, kommentiert und weiterentwickelt. Auch die Eltern erhalten im Rahmen einer Abendveranstaltung Gelegenheit, sich zu informieren, selbst praktische Erfahrungen mit KI zu sammeln und an der Entwicklung des „KI-Kodex“ mitzuwirken. Dieses partizipative Vorgehen eröffnet uns die Chance auf eine schulweit abgestimmte Erklärung, die nicht nur Regeln definiert, sondern vor allem Orientierung bietet und eine Haltung sichtbar macht.
Die Fortbildungsreihe hat damit einen wichtigen Impuls gegeben – nicht nur für den Aufbau digitaler Kompetenzen, sondern auch für eine gemeinsame Verständigung darüber, wie wir als Schule mit KI umgehen wollen. Sie hat Räume eröffnet, in denen Neues ausprobiert, Sorgen geteilt und gemeinsame Haltungen weiterentwickelt werden konnten. Die regelmäßigen Feedback-Schleifen haben gezeigt, dass die Kolleg:innen die Formate als gewinnbringend erlebt und vielfältige Einsatzmöglichkeiten entdeckt und in den Unterricht integriert haben.
In einer Schule, die das gemeinsame Lernen in seiner Vielfalt ernst nimmt, ist es entscheidend, dass neue Technologien nicht unreflektiert übernommen, sondern im Einklang mit den pädagogischen Zielen weiterentwickelt werden. Dazu gehört auch, das Soziale im Lernen zu bewahren, kooperative Strukturen zu stärken und die Dimension des „Lernens ohne KI“ nicht aus dem Blick zu verlieren. Analoges, zwischenmenschliches, erfahrungsbezogenes Lernen wird auch in Zukunft neben den vielfältigen digitalen Möglichkeiten ein zentraler Bestandteil unserer Schulkultur bleiben.
(1) nach Susanne Alles, Joscha Falk, Manuel Flick und Regina Schulz
InEigenerSache
D. Zielinski: Abschied von Sabine Schmitt
hier lesen
Abschied aus der Geschäftsstelle
Sabine Schmitt geht zum 31.12.2025 in den Ruhestand
Dieter Zielinski
Im Jahr 2019 war unsere Geschäftsstelle in einer schwierigen Situation. Der hauptamtliche Geschäftsführer war ausgeschieden. Damit verbunden war ein Wechsel der Bundesgeschäftsstelle von Stedesdorf nach Dortmund. Die Abläufe in der Geschäftsstelle mussten neu aufgestellt werden und wir benötigten eine neue Mitarbeiterin bzw. einen neuen Mitarbeiter. Durch einen glücklichen Zufall wurden wir auf Sabine Schmitt aufmerksam gemacht.
Am 01.05.2019 nahm Sabine ihre Arbeit bei uns auf. Sie brauchte keine Einarbeitungszeit. Sie war sofort präsent und hat aktiv mit unserem damaligen ehrenamtlichen Geschäftsführer Werner Kerski die Neustrukturierung in die Hand genommen.
Ich habe Sabine zum ersten Mal während unseres Bundeskongresses 2019 in Berlin erlebt. Sie hatte alles im Blick und bestens vorbereitet. Nachdem ich in den Bundesvorstand gewählt worden war, bekam ich einen tieferen Einblick in ihre Arbeit. Ich glaube, dass es nicht übertrieben ist, wenn ich sage, dass die Strukturen und Arbeitsabläufe der Geschäftsstelle von ihr geschaffen wurden. Davon hat die gesamte GGG profitiert, insbesondere natürlich ich als Vorsitzender und Andreas Baumgarten als Nachfolger von Werner Kerski als Geschäftsführer.
Etwas Besseres hätte der GGG gar nicht passieren können.
Besonders beeindruckt hat mich immer wieder ihre Empathie, mit der sie den Menschen, mit denen sie es zu tun hatte, begegnete. Sabine hat nicht nur verwaltet, sondern mitgedacht, vorausgedacht und initiativ gehandelt. Wir konnten uns immer auf sie verlassen. Das hat viel dazu beigetragen, dass die Ehrenamtlichen sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren konnten. Sabine war eine Kümmerin, sei es in der Vorbereitung unserer Hauptausschusssitzungen oder auch unserer Bundeskongresse 2019 in Berlin und im letzten Jahr in Dresden.
Ihr ging immer auch um die Atmosphäre, zuletzt bei den Einstellungsgesprächen für eine Nachfolgerin. Hier hat sie für Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Blumen gesorgt. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, war die Reaktion der Bewerberinnen.
Zum 31.12.2025 geht Sabine in den wohlverdienten Ruhestand.
Rückblickend können wir sagen, dass Sabine ein Glückslos für die GGG war. Sie wird uns fehlen. Wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten und wünschen ihr alles, alles Gute.
Danke liebe Sabine!
A. Meisner: Neue Website
hier lesen
Überarbeitete Homepage der GGG
Andreas Meisner
Zum Jahreswechsel wird eine überarbeitete Homepage der GGG unter www.ggg-web.de zu finden sein. Ziel der Umgestaltung ist, eine im Design zeitgemäße Visitenkarte der GGG im Internet zu haben. Die bisher bekannten Funktionen der Seite sollen auch weiterhin erhalten bleiben. Die Oberfläche wird dazu nutzerfreundlich in der Menüführung gestaltet.
Für die Landesverbände wird auch weiterhin eine Plattform zur Verfügung gestellt, um regionale Informationen zu veröffentlichen. Dazu werden die Landesverbände nach ihren Möglichkeiten Redakteure stellen. Die hinter der Seite stehende Technik ist so gestaltet, dass nach kurzer Einarbeitung eine Redaktionsarbeit ohne große technische Hürden möglich ist.
Es wird auch weiterhin einen gesicherten Mitgliederbereich geben, in dem Mitglieder nach Anmeldung verbandsinterne Informationen wie. z.B. Protokolle von Mitgliederversammlungen u.ä. einsehen können.
Wir bitten die Mitglieder die Homepage zu besuchen und Rückmeldungen zu geben, wo sie einen Verbesserungsbedarf in der Nutzung sehen. Dies kann dann in die Seite eingepflegt werden. Anregungen bitte an .
Leserbriefe
Wenn Sie zum vorliegenden Heft etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns bitte einen Leserbrief.
