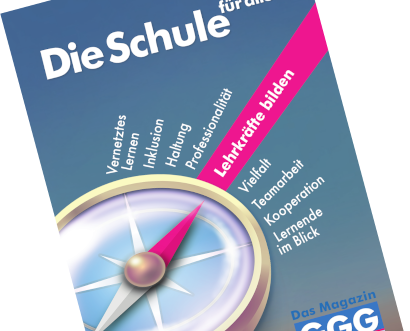Joachim Lohmann liefert der GGG neue Daten zur unerträglichen Ungleichheit der Bildungschancen. Seine eindrucksvolle Analyse wird heftige Reaktionen hervorrufen.
Die ungleichen Bildungschancen sind unerträglich
Die Aufhebung der Bildungsbenachteiligung ist das Kernthema der GGG seit ihrem Bestehen.
Ihre Gründung hatte nur ein Ziel: nämlich für die Durchsetzung der Chancengleichheit und das längere gemeinsame Lernen zu kämpfen. Damals hieß das, sich dafür einzusetzen, dass Gesamtschulen gegründet und bei ihrer Entwicklung unterstützt wurden.
Von Anfang an war die Einführung der Gesamtschule umstritten. Einige alte Bundesländer folgten der Aufforderung des Deutschen Bildungsrates 1969 zur Durchführung von Schulversuchen mit Gesamtschulen nur sehr zögerlich. Es folgten bildungspolitische Konfrontationen und Grabenkämpfe um die Gesamtschule, bis auch die SPD-Spitze für das Ende der Strukturdebatte eintrat, und die meisten Länder fügten sich.
Als mit der ersten PISA-Veröffentlichung 2000 augenfällig wurde, wie schwach das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich abschnitt und wie wenig gerade die deutschen Schulen soziale Herkunftsbedingungen auszugleichen in der Lage waren, stellte sich die Systemfrage erneut: Längeres gemeinsames Lernen gegen frühe Selektion. Doch die meisten Länder wollten die Systemfrage umgehen, suchten erneut nach Einwänden und versuchten sich in Alternativen.
Auch das deutsche PISA- Konsortium hat die internationalen Daten nicht skandalisiert und weitere Untersuchungen z.B. über die Qualität der Gesamtschulen angestrengt (s. Ergebnisse des Deutschen Schulpreises). Stattdessen wurden die Argumente für eine Schule für alle Kinder und Jugendlichen relativiert.
Dank Schülerrückgang und Elterndruck, die den Hauptschulbesuch für ihre Kinder nicht mehr wollen, und dank einiger beherzter bildungspolischer Kräfte beginnt die Schulstruktur sich trotzdem zugunsten einer Zweigliedrigkeit zu verändern.
Doch gegen die Gleichwertigkeit der neuen Schulformen, gegen gleiche Bildungsgänge und eine einheitliche Lehrerbildung baut sich eine neue Front auf, um jeglicher Gefahr zu begegnen, dass sich eine gemeinsame Schule für alle entwickeln könnte. Denn der Mythos vom Erfolg homogener Lerngruppen bleibt gegen alle empirischen Befunde wirkmächtig. In einer latent immer noch ständisch gegliederten Gesellschaft hat der Schutz des Gymnasiums oberste Priorität für die Kinder der Eltern, die ihren Bildungsstand „vererben“ wollen.
Joachim Lohmann, langjähriger Vorsitzender der GGG, stellt sich gegen die gesellschaftspolitischen Vorbehalte und überkommenen Mythen. Auf der Basis der PISA-Daten hat er allein, was eigentlich die Aufgabe einer mit hinreichend Ressourcen ausgestatteten Kommission gewesen wäre, sorgfältig die gängigsten Einwände gegen die Strukturreform auf ihre statistische Haltbarkeit überprüft.
Ausgangspunkt von Lohmanns Beitrag sind die sozialen Leistungsunterschiede, die nur in wenigen Staaten der OECD größer sind als in Deutschland. Nach seinen Analysen sind es weder die ethnischen noch die genetischen Unterschiede noch die Sozialstruktur, die die Unterschiede zwischen den Staaten bewirken. Der Leistungsunterschied von Schülerinnen und Schülern, seien sie sozial bevorzugt oder benachteiligt, beträgt in Deutschland 3 ½ Schuljahre, je nachdem, ob sie sozial privilegierte oder unterprivilegierte Schulen besuchen. Er differiert auch zwischen verschiedenen Staaten, aber in keinem Land stärker als in Deutschland. Die Differenz kann nur durch die strukturelle Schulsituation erklärt werden.
Auch der so hochgejubelte Elementarbereich kann die Schulunterschiede nicht aufwiegen, denn andere Staaten schaffen den Leistungsvorsprung auch unabhängig vom Kindergarten.
Selbst die Wirkung der Ganztagsschule, die viele nur widerstrebend und in der Hoffnung, sich damit der Strukturfrage entledigen zu können, eingeführt haben, ist begrenzt. Sie schafft nur dann mehr Chancengleichheit, wenn sie in einem sich als human und sozial verstehenden Schulkonzept realisiert wird. Mit anderen Worten: Sie wirkt am positivsten als Gesamtschule.
So hat Lohmann weitere Einwände unter die Lupe genommen und ist zu überraschenden Ergebnissen gekommen. Z.B. ist das Schülerverhalten nicht nur individuell und gesellschaftlich bedingt, sondern ebenfalls durch die Schulstruktur mitbestimmt. Sicher kommt es auf die Lehrerin und den Lehrer an, aber die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, das Klima, das sie verbreiten und wie stark sie motivieren, hängt erheblich von der Schulstruktur ab.
Mithin bleibt die Reform der Schulstruktur der entscheidende Faktor, um die Chancengleichheit zu erhöhen und die Leistung bei allen zu steigern. Längeres gemeinsames Lernen erhöht nicht nur die Lern- und Entwicklungschancen der Kinder und Jugendlichen. Es hat auch positive Folgewirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander und die Arbeitsmarktpolitik. Wie will die Bundesrepublik denn die von ihr ratifizerte Behindertenrechtskonvention einlösen, wenn sie schon im schulischen Bereich versagt?
Lohmanns eindrucksvolle Analyse wird heftige Reaktionen hervorrufen. Aber Gegenwind gehört zur Geschichte der GGG, solange sie ihr Kernthema nicht aus den Augen verliert.
Klaus Winkel

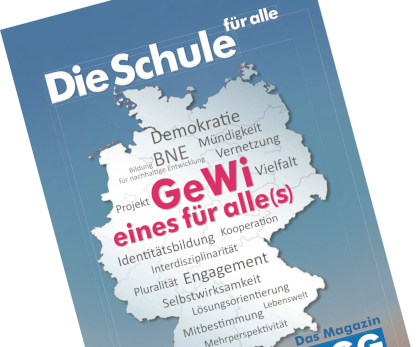
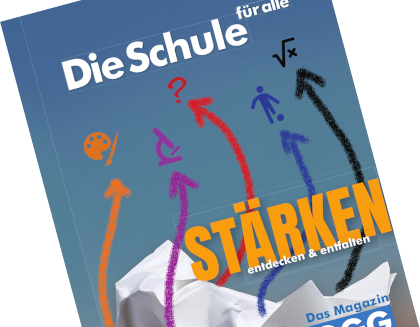
 Die Umwelthilfe, einer unserer Kooperationspartner, hat sich an alle Bundesländer gewandt. Die GGG hat sich dem offenen Brief an die Umwelt-, Kultus- und Bauministerien angeschlossen.
Die Umwelthilfe, einer unserer Kooperationspartner, hat sich an alle Bundesländer gewandt. Die GGG hat sich dem offenen Brief an die Umwelt-, Kultus- und Bauministerien angeschlossen.